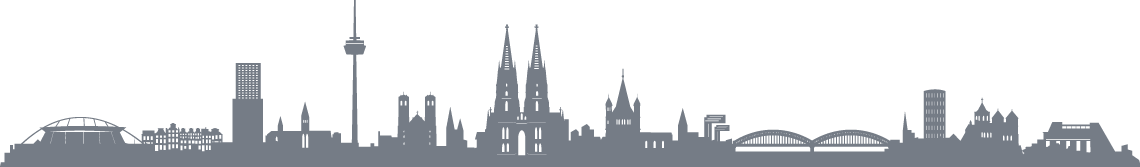Die Mohrenstraße in Berlin-Mitte war über Jahre Gegenstand von Diskussionen wegen ihres umstrittenen Namens. Nun hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg entschieden, dass die Umbenennung der Straße – künftig Anton-Wilhelm-Amo-Straße – rechtmäßig ist und von den Anwohnenden hingenommen werden muss. Der Beschluss vom 08.07.2025 (Az.: OVG 1 N 59/23) bestätigte das erstinstanzliche Urteil des Verwaltungsgerichts (VG) Berlin und machte den Namenswechsel endgültig rechtskräftig.
Hintergrund: Streit um den Straßennamen „Mohrenstraße“
Der Name „Mohrenstraße“ wird seit Jahren in Berlin kritisiert, da das Wort Mohr heute als abwertender Begriff für Schwarze Menschen gilt. Bereits 2020 gab es breite öffentliche Debatten und politische Initiativen, den kolonial geprägten Straßennamen zu ändern. Auf Initiative der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Mitte – unter dem Motto „Anton Wilhelm Amo Straße jetzt!“ – beschloss das Bezirksamt Mitte schließlich, die Mohrenstraße umzubenennen. Namensgeber des neuen Straßennamens ist Anton Wilhelm Amo (1703–1759), der als erster afrodeutscher Gelehrter und Akademiker in Deutschland gilt. Die offizielle Allgemeinverfügung zur Umbenennung wurde am 4. Mai 2021 im Berliner Amtsblatt bekannt gemacht. Damit war formal festgelegt, dass die Mohrenstraße fortan den Namen Anton-Wilhelm-Amo-Straße tragen sollte.
Anwohnende klagen gegen die Umbenennung
Gegen die Umbenennung regte sich Widerstand vonseiten einiger Anwohnerinnen und Anwohner der Mohrenstraße. Mehrere Betroffene legten Widerspruch gegen die Allgemeinverfügung ein und zogen anschließend vor Gericht, da sie die Maßnahme für rechtswidrig hielten. Sie monierten unter anderem, sie seien nicht ausreichend beteiligt worden, die Begründung für die Umbenennung sei falsch (insbesondere bestritten sie, dass der historische Name tatsächlich rassistisch gemeint war) und die Behörden hätten Vorschriften des Landesrechts zur Straßenbenennung missachtet.
Einer der Kläger – ein Historiker, der in der Mohrenstraße wohnt – wurde als Musterkläger angesehen, dessen Fall stellvertretend entschieden werden sollte. Das Verwaltungsgericht Berlin wies seine Klage jedoch am 06.07.2023 ab. Wichtig zu wissen: Schon zuvor hatte das VG eine Klage eines Mannes abgewiesen, der gar nicht an der Mohrenstraße wohnte. Das Gericht stellte in jenem Verfahren klar, dass nur Anwohner überhaupt klagebefugt seien, da neben einem möglichen Verstoß gegen das Willkürverbot auch eine Verletzung eigener verfassungsrechtlich geschützter Rechte vorliegen müsse – und solche Rechte könnten nur Anwohner der betroffenen Straße geltend machen. Nicht-Anwohner haben demnach keine rechtliche Handhabe, sich gegen eine Straßenumbenennung zu wehren, weil ihnen die hierfür erforderliche Betroffenheit fehlt.
Straßenumbenennung als Allgemeinverfügung im öffentlichen Interesse
Straßenbenennungen und -umbenennungen sind nach Berliner Landesrecht Aufgabe der Bezirke (gemäß Berliner Straßengesetz). Juristisch handelt es sich bei der Änderung eines Straßennamens um eine adressatenlose Allgemeinverfügung, also einen Verwaltungsakt, der nicht an einzelne Personen, sondern an die Öffentlichkeit gerichtet ist und den Status einer Sache – hier den Namen der Straße – regelt. Solche Maßnahmen dienen allein dem öffentlichen Interesse, etwa der öffentlichen Ordnung, historischen Aufarbeitung oder Wahrung von Anstand im Straßenbild. Im Fall der Mohrenstraße stand das öffentliche Interesse im Vordergrund, einen als rassistisch empfundenen Namen durch eine ehrenvolle Benennung (nach Anton Wilhelm Amo) zu ersetzen.
Für Anwohner bedeutet dies, dass eine Straßenumbenennung kein individueller Verwaltungsakt ihnen gegenüber ist. Sie werden zwar von der Änderung faktisch betroffen (z. B. durch Adressänderungen auf Briefköpfen, Ausweisen etc.), sind aber nicht Adressaten der Maßnahme. Daher besteht kein subjektives Recht auf Beibehaltung eines Straßennamens. Die typischen Unannehmlichkeiten (Ummeldung des Wohnsitzes, Austausch von Visitenkarten, eventuelle Kosten für neue Briefkästen oder Firmenschilder) gelten als sozial übliche Belastungen, die grundsätzlich von jedermann hinzunehmen sind. Die Gerichte verlangen lediglich, dass die Behörden solche Folgen im Blick haben und keine unzumutbaren Härten verursachen. In der Praxis werden den Betroffenen oft Übergangsfristen eingeräumt (z. B. Postzustellung eine Zeit lang an alte und neue Anschrift), sodass die Belastungen gering gehalten werden.
Willkürverbot als Maßstab der gerichtlichen Kontrolle
Da Straßenumbenennungen vornehmlich dem Allgemeinwohl dienen, ist der gerichtliche Prüfungsmaßstab im Anfechtungsfall stark eingeschränkt. Die Verwaltungsgerichte überprüfen eine solche Entscheidung im Wesentlichen nur darauf, ob die Behörde gegen das Willkürverbot verstoßen hat. Willkürverbot bedeutet: Die Behörde darf nicht völlig sachfremd, ohne nachvollziehbaren Grund oder grob unverhältnismäßig handeln. Vereinfacht gesagt muss ein legitimer Sachgrund für die Umbenennung vorliegen, und die Entscheidung darf kein „Ausreißer“ sein, der jede sachliche Rechtfertigung vermissen lässt. Solange einleuchtende Gründe bestehen und die Belange der Betroffenen nicht völlig außer Acht gelassen werden, wird eine gerichtliche Überprüfung die Entscheidung respektieren.
Im Fall der Mohrenstraße betonte das VG Berlin, dass es bei der Klage nicht um eine historische oder politische Bewertung des Begriffs „Mohr“ ging – diese Frage war für das Gericht nicht entscheidungserheblich. Stattdessen stand ausschließlich die verwaltungsrechtliche Frage im Mittelpunkt, ob das Bezirksamt mit der Umbenennung seine Befugnisse rechtmäßig ausgeübt hat. Dabei kam das Gericht (und in der Folge das OVG) zu dem Ergebnis, dass keine Willkür vorliegt. Es gebe zwar „eine Menge Für und Wider“ in der öffentlichen Debatte um den Namen, aber ausschlaggebend war, dass die Entscheidung des Bezirksamts auf sachlichen Erwägungen beruhte und vertretbar ist. Insbesondere ist es nicht völlig unvertretbar, den gewandelten gesellschaftlichen Anschauungen Rechnung zu tragen – viele Menschen empfinden die Bezeichnung „Mohr“ für Schwarze heute als anstößig. Folglich hatte das Bezirksamt mit der Umbenennung einen nachvollziehbaren, sachlichen Grund und verletzte damit nicht das Willkürverbot.
Das OVG Berlin-Brandenburg hat diese Sicht der Dinge vollumfänglich bestätigt. In seinem Beschluss vom 08.07.2025 stellte es klar, dass keine ernstlichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit des erstinstanzlichen Urteils bestehen. Straßenumbenennungen liegen im weiten Ermessen der zuständigen Behörden, und die Gerichte schreiten nur ein, wenn die Grenzen dieses Ermessens in krasser Weise überschritten wurden – was hier gerade nicht der Fall war. Im Ergebnis können die Anwohnenden daher keine Rechtsverletzung geltend machen, da weder eine Willkürhandlung noch ein anderer Grundrechtseingriff vorlag.
Öffentliches Interesse überwiegt – geringe Erfolgsaussichten für Anwohnerklagen
Die Umbenennung der Mohrenstraße in Anton-Wilhelm-Amo-Straße ist nun endgültig rechtskräftig. Der Fall verdeutlicht die rechtlichen Maßstäbe bei Straßenumbenennungen und zeigt, dass das öffentliche Interesse an angemessenen und nicht diskriminierenden Straßennamen in der Regel Vorrang vor den Interessen Einzelner hat. Für juristisch interessierte Laien lassen sich aus diesem Urteil folgende Lehren ziehen:
- Weites Ermessen der Behörden: Kommunale Gremien (wie hier das Bezirksamt) haben einen großen Spielraum bei der Benennung und Umbenennung von Straßen. Ihre Entscheidungen dienen dem Allgemeinwohl, z.B. der historischen Aufarbeitung oder der Vermeidung diskriminierender Bezeichnungen.
- Begrenzter Rechtsschutz für Betroffene: Anwohner*innen einer umbenannten Straße können zwar rechtlich dagegen vorgehen, allerdings nur mit geringen Erfolgsaussichten. Die Gerichte prüfen im Wesentlichen nur, ob die Behörde willkürlich – also ohne sachlichen Grund oder grob unverhältnismäßig – gehandelt hat. Normale Unannehmlichkeiten wie Adressänderungen oder geringe Kosten reichen als Rechteingriff nicht aus, um eine Umbenennung zu kippen.
- Willkürverbot als entscheidende Schranke: Solange die Verwaltung einen sachlichen Grund für den neuen Namen hat und verhältnismäßig vorgeht, ist die Maßnahme rechtmäßig. Im Mohrenstraßen-Fall erkannte das Gericht ausdrücklich an, dass die Berücksichtigung geänderter gesellschaftlicher Werte – nämlich das Vermeiden eines heute als abwertend empfundenen Begriffs – ein legitimer Grund für die Umbenennung war.
- Bürgerbeteiligung und Transparenz: Obwohl Anwohnende kein Recht auf Anhörung vor einer Straßenumbenennung haben, achten Politik und Verwaltung in der Regel darauf, die Öffentlichkeit vorab zu informieren. Im Bezirk Mitte wurde die Diskussion um den Namen jahrelang öffentlich geführt. Bürger können ihre Meinung in Bezirksverordnetenversammlungen oder via Einwohneranträge einbringen. Letztlich entscheidet aber das zuständige Organ im Rahmen seiner gesetzlichen Befugnis.
Zusammengefasst: Die Hürden für Anwohner, eine Straßenumbenennung juristisch zu verhindern, sind sehr hoch. Die Gerichte werden eine solche kommunale Entscheidung nur in Ausnahmefällen aufheben – etwa wenn sie völlig aus der Luft gegriffen wäre oder formell gravierende Fehler aufweist. Im Normalfall gilt: Das öffentliche Interesse an einer sinnvollen, zeitgemäßen Straßenbenennung überwiegt die individuellen Interessen am alten Namen. Im Falle der Mohrenstraße bedeutete das, dass die Bewohner mit dem neuen Namen leben müssen, auch wenn er mit Aufwand und Veränderungen einhergeht. Für die Stadtgesellschaft hingegen steht das Urteil sinnbildlich dafür, dass historisch belastete Namen geändert werden können, sofern dies sachlich gerechtfertigt ist und fair abgewogen wurde. So wird das Stadtbild schrittweise an heutige Wertvorstellungen angepasst – auf rechtlich zulässige Weise, wie das OVG bestätigt hat.
Rechtstipp: Wer sich durch die Umbenennung einer Straße betroffen fühlt, sollte zunächst den Dialog mit der örtlichen Politik suchen, anstatt allein auf ein Gerichtsverfahren zu vertrauen. Die Erfolgsaussichten einer Klage sind – wie der Fall Mohrenstraße zeigt – gering, solange die öffentliche Hand nachvollziehbare Gründe für den Namenswechsel hat und kein willkürliches Handeln vorliegt.