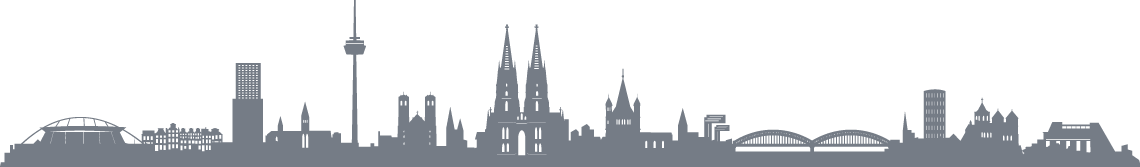Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 06.08.2025 (Az. VIII ZR 161/24) entschieden, dass der Verkauf eines Mietshauses an eine GmbH & Co. KG nicht den Startschuss für die Kündigungssperrfrist bei Eigenbedarfskündigungen auslöst. Mit diesem Urteil stärkt der BGH den Mieterschutz und sorgt für Klarheit: Wird vermieteter Wohnraum zunächst an eine Personenhandelsgesellschaft (wie eine GmbH & Co. KG) verkauft und später als Eigentumswohnungen an Privatpersonen veräußert, beginnt die Sperrfrist erst mit dem Verkauf der Wohnung an den privaten Erwerber. Für Mieter bedeutet das im Ergebnis mehr Schutz vor schnellen Eigenbedarfskündigungen, während Vermieter die verlängerten Wartezeiten einkalkulieren müssen.
Hintergrund: Kündigungssperrfrist nach § 577a BGB
Bei der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen gilt ein besonderer Mieterschutz. Nach § 577a Abs. 1 BGB kann ein neuer Eigentümer erst nach Ablauf von mindestens drei Jahren nach Erwerb der Wohnung wegen Eigenbedarfs kündigen. In Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt – wie z.B. München oder Berlin – wurde diese Sperrfrist durch Landesverordnung sogar auf bis zu zehn Jahre verlängert. Die Regelung soll verhindern, dass Mieter unmittelbar nach dem Wohnungsverkauf “unter die Räder kommen”: Oft kaufen Investoren Mietshäuser, wandeln sie in Eigentumswohnungen um und verkaufen sie mit Gewinn an Selbstnutzer. Ohne Sperrfrist könnten die neuen Wohnungseigentümer die bisherigen Mieter sofort per Eigenbedarfskündigung zum Auszug zwingen.
Umgehungsgefahr: Das „Münchener Modell“
In der Vergangenheit entwickelten findige Investoren jedoch Schlupflöcher, um die Sperrfrist zu umgehen. Bekannt wurde vor allem das „Münchener Modell“: Dabei erwirbt eine eigens gegründete Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) oder eine Gruppe von Käufern ein ganzes Mietshaus anstatt einzelner Wohnungen. Noch bevor die Wohnungen in Eigentumswohnungen aufgeteilt und verkauft werden, kündigt diese Erwerbergemeinschaft einzelnen Mietern wegen Eigenbedarfs der Gesellschafter. Da hier die gesetzliche Reihenfolge – erst Umwandlung, dann Verkauf – umgedreht wurde, griff die ursprüngliche Kündigungssperrfrist des § 577a Abs. 1 BGB nicht. Mieter liefen so Gefahr, ihren Wohnraum zu verlieren, obwohl formal (noch) keine Wohnungseigentumsumschreibung stattfand.
Der Gesetzgeber reagierte 2013 auf diese Umgehungspraxis und erweiterte § 577a BGB. Nach § 577a Abs. 1a BGB gilt die Sperrfrist nun entsprechend auch dann, wenn vermieteter Wohnraum ohne vorherige Umwandlung an eine Personengesellschaft oder an mehrere Erwerber verkauft wird. In solchen Fällen beginnt die Frist gemäß § 577a Abs. 2a BGB sogar bereits mit dem Kauf durch die Personenmehrheit – eine spätere Aufteilung in Wohnungen löst dann keine neue Frist mehr aus. Damit wollte der Gesetzgeber sicherstellen, dass auch im „Münchener Modell“ die Sperrfrist frühzeitig greift und Mieter nicht durch Konstruktionen mit Gesellschaften um ihren Schutz gebracht werden.
Der Fall: Verkauf eines Mietshauses an eine GmbH & Co. KG
Im jetzt entschiedenen Fall aus München ging es um genau so ein Konstrukt – jedoch mit einem wichtigen Unterschied. Eine GmbH & Co. KG (eine Personengesellschaft in Form einer Kommanditgesellschaft) hatte 2012 ein Mietshaus in München gekauft und anschließend in Eigentumswohnungen aufgeteilt. 2016 verkaufte diese Gesellschaft eine der neu gebildeten Eigentumswohnungen an ein privates Ehepaar (die Kläger), das Anfang 2017 als neue Eigentümer im Grundbuch eingetragen wurde. Fünf Jahre später – im September 2022 – kündigten die neuen Eigentümer den Mietern der Wohnung wegen Eigenbedarfs und verlangten die Räumung zum 31.03.2023.
Die Mieter weigerten sich und beriefen sich auf die Kündigungssperrfrist nach § 577a BGB. Ihrer Ansicht nach hatte die zehnjährige Sperrfrist in München erst mit dem Erwerb der Wohnung durch die neuen Eigentümer 2017 begonnen und liefe folglich bis 2027. Eine Eigenbedarfskündigung im Jahr 2022 – also nach erst fünf Jahren – sei daher unwirksam. Die Vermieter hingegen meinten, die Sperrfrist habe schon 2012 mit dem Kauf des Hauses durch die GmbH & Co. KG begonnen (nach ihrer Auffassung als Fall des § 577a Abs. 1a BGB) und sei bei Kündigung somit bereits abgelaufen. Die zentrale Rechtsfrage war also: Löst der Verkauf an eine GmbH & Co. KG die Sperrfrist aus?
Entscheidung des BGH: Sperrfrist beginnt beim ersten Wohnungserwerber
Der BGH hat zugunsten der Mieter entschieden und die Räumungsklage der Vermieter abgewiesen. Der Verkauf an die GmbH & Co. KG im Jahr 2012 hat die Kündigungssperrfrist nicht in Lauf gesetzt. Die Sperrfrist begann (wie im Grundfall des § 577a Abs. 1 BGB) erst mit der Veräußerung der umgewandelten Wohnung an die Kläger im März 2017. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Ehepaar als Eigentümer im Grundbuch eingetragen – dieses Datum ist maßgeblich für den Fristbeginn Da in München eine zehnjährige Sperrfrist gilt, hätten die Vermieter frühestens 2027 wegen Eigenbedarfs kündigen dürfen. Die Eigenbedarfskündigung im Jahr 2022 war folglich verfrüht und unwirksam.
Entscheidend war die Auslegung der Begriffe „Personengesellschaft“ und „Erwerbermehrheit“ in § 577a Abs. 1a BGB. Der BGH stellte klar, dass diese Vorschrift teleologisch reduziert werden muss. Nur bei bestimmten Gesellschaftsformen – nämlich einer GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) oder einer rein tatsächlichen Erwerbergemeinschaft (Miteigentümergemeinschaft) – besteht die besondere Gefahr, die § 577a Abs. 1a BGB adressiert. In solchen Konstellationen können bereits mit dem Hauskauf Eigenbedarfsansprüche der Gesellschafter geltend gemacht werden, was ein erhöhtes Verdrängungsrisiko für Mieter bedeutet.
Anders bei einer GmbH & Co. KG oder anderen Personenhandelsgesellschaften: Diese können nicht wegen Eigenbedarfs eines Gesellschafters kündigen. Eine Kommanditgesellschaft ist rechtlich ein eigenständiges Konstrukt – der Eigenbedarf einer Privatperson (eines Gesellschafters) kann ihr nicht zugerechnet werden. Deshalb sah der BGH keine vergleichbare Gefahr für die Mieter und keinen Anlass, die Sperrfrist auf solche Fälle auszudehnen. Der Wortlaut „Personengesellschaft“ in § 577a Abs. 1a BGB sei insofern „zu weit gefasst“ und im Lichte von Sinn und Zweck einzuschränken Die Sperrfrist aus § 577a BGB wird durch den bloßen Kauf eines Hauses durch eine GmbH & Co. KG also nicht ausgelöst.
Bedeutung für die Praxis: Tipps für Mieter und Vermieter
- Mieter: Für Mieter bringt dieses Urteil Klarheit und Sicherheit. Wurde Ihr Mietshaus zunächst von einer Personenhandelsgesellschaft (z.B. einer GmbH & Co. KG oder OHG) erworben und erst später Ihre Wohnung an einen privaten Eigentümer verkauft, beginnt die Kündigungssperrfrist erst mit diesem Erwerb. Sie genießen also den vollen Schutzzeitraum (mindestens 3, in vielen Städten 10 Jahre) ab Eigentumsübertragung an den neuen Vermieter. Eine Eigenbedarfskündigung vor Ablauf dieser Frist ist unzulässig – selbst wenn das Haus jahrelang einer Gesellschaft gehörte. Im vorliegenden Fall bedeutete das für die Münchner Mieter: Die zehnjährige Sperrfrist lief ab 2017 und war 2022 noch nicht abgelaufen, sodass die Kündigung unwirksam war.
- Vermieter: Für Vermieter bzw. Käufer von Immobilien zeigt das Urteil Grenzen auf. Umgehungskonstruktionen mittels GmbH & Co. KG oder ähnlichen Gesellschaftsformen bieten keinen Vorteil beim Kündigungsschutz. Auch wenn eine Personenhandelsgesellschaft das Gebäude zuvor gehalten hat, müssen neue Eigentümer die Sperrfrist voll abwarten, bevor sie wegen Eigenbedarfs kündigen dürfen. Planen Sie also den Eigenbedarf rechtzeitig ein und prüfen Sie, ab wann die Sperrfrist in Ihrem Fall zu laufen beginnt. Nur in echten „Münchener Modell“-Fällen – etwa beim Erwerb durch eine GbR, die schon für ihre Gesellschafter kündigen könnte – greift die Sperrfrist bereits mit dem Hauskauf. In allen anderen Fällen gilt: Erst Eigentumswohnungserwerb, dann Sperrfrist, und erst danach ist eine Kündigung wegen Eigenbedarfs möglich.
Der BGH sorgt mit dieser Entscheidung für Rechtssicherheit. Verkäufe an Personenhandelsgesellschaften wie die GmbH & Co. KG lösen keine Kündigungssperrfrist aus – diese beginnt erst mit dem ersten echten Wohnungsverkauf an einen Selbstnutzer. Für Mieter bedeutet das längeren Bestandsschutz, für (künftige) Vermieter eine längere Wartezeit bis zur möglichen Eigenbedarfskündigung. Insgesamt wird damit der Schutzzweck des § 577a BGB – die Verzögerung von Eigenbedarfskündigungen nach Wohnungsumwandlungen – konsequent umgesetzt.