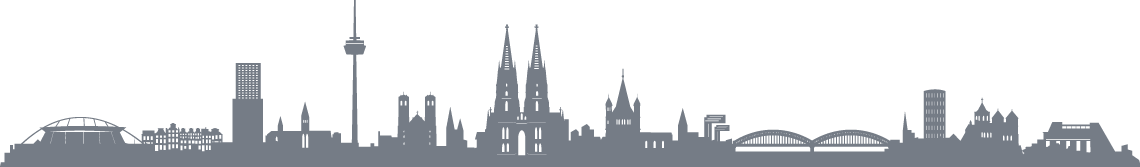Die Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) stehen oft vor der Frage, wie sie bei der Beauftragung einer Anwaltskanzlei vorgehen sollen. Bisher wurde von einigen Gerichten verlangt, mehrere Vergleichsangebote einzuholen, bevor man sich für einen Anwalt entscheidet. Doch ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 18.07.2025 (Az. V ZR 76/24) schafft nun klare Verhältnisse: WEG müssen vor der Anwaltsbeauftragung keine Alternativangebote einholen, auch wenn Instanzgerichte dies zuvor gefordert hatten. Die Wahl des Rechtsanwalts ist Vertrauenssache, so die Kernaussage des BGH. In diesem Rechtstipp erklären wir die Hintergründe des Urteils, was es für Wohnungseigentümer und Verwalter bedeutet und geben praktische Empfehlungen für den Umgang mit Anwaltsbeauftragungen in der WEG.
Hintergrund: Bisherige Praxis und Unsicherheit
In der Vergangenheit war es in der WEG-Praxis üblich, bei größeren Ausgaben oder Vertragsabschlüssen mehrere Angebote einzuholen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Instanzgerichte – also Amts- und Landgerichte – hatten teils entschieden, dass mindestens drei Vergleichsangebote vorliegen sollten, bevor die Gemeinschaft z.B. einen Handwerker, Verwalter oder einen Anwalt beauftragt. Der Gedanke dahinter: Die Eigentümer sollen Preise und Leistungen vergleichen können, um wirtschaftlich vernünftig zu handeln und überteuerte Aufträge zu vermeiden.
Gerade bei baulichen Maßnahmen oder Reparaturen am Gemeinschaftseigentum galt die Pflicht zur Einholung mehrerer Angebote als Teil der ordnungsmäßigen Verwaltung. Auch für Dienstleistungen wie Rechtsanwälte oder Sachverständige forderten einige Gerichte bislang einen Preisvergleich durch Alternativangebote. Viele Eigentümer und Verwalter waren deshalb verunsichert: Macht man etwas falsch, wenn man direkt „seinen Vertrauensanwalt“ beauftragt, ohne drei Kanzleiangebote verglichen zu haben?
BGH-Urteil 2025: Keine Pflicht zu Vergleichsangeboten bei Anwaltswahl
Der Bundesgerichtshof hat nun mit seinem Urteil vom 18. Juli 2025 (V ZR 76/24) für Klarheit gesorgt. Die obersten Zivilrichter stellen ausdrücklich fest: Bei der Beschlussfassung über die Beauftragung eines Rechtsanwalts müssen keine Alternativangebote anderer Anwälte vorliegen – selbst dann nicht, wenn eine Honorarvereinbarung getroffen werden soll. Diese Grundsatzentscheidung bedeutet einen Kurswechsel gegenüber vielen vorherigen Instanzurteilen. Die Wohnungseigentümergemeinschaft darf also einen Anwalt ihrer Wahl beauftragen, ohne zuvor Konkurrenzangebote einzuholen.
Der BGH stellte zugleich klar, dass dieselbe Regel für die Beauftragung von Gutachtern gilt. In dem entschiedenen Fall ging es um Baumängel am Gemeinschaftseigentum: Die Verwalterin hatte wegen drohender Verjährung ohne vorherigen Beschluss drei Sachverständige und eine Anwaltskanzlei im Namen der WEG beauftragt, um Gutachten einzuholen und Ansprüche zu sichern. Später genehmigte die Eigentümerversammlung diese Beauftragungen nachträglich und ermächtigte die Verwalterin, mit der Kanzlei eine Honorarvereinbarung (300 € pro Anwaltsstunde, 150 € pro Sekretariatsstunde) abzuschließen.
Während das Amtsgericht München die Beschlüsse für ordnungsgemäß hielt, sah das Landgericht München I dies anders: Ohne mindestens drei Alternativangebote könne weder ein Anwalt noch ein Gutachter wirksam beauftragt werden, so das LG. Der BGH hat dieses Urteil jedoch aufgehoben und die amtsgerichtliche Entscheidung wiederhergestellt. Damit wurde höchstrichterlich entschieden, dass eine WEG-Beschlussfassung nicht allein wegen fehlender Vergleichsangebote unwirksam ist.
Gründe des BGH: Warum kein Preisvergleich nötig ist
Warum weicht der BGH von der bisherigen Linie ab? Die Karlsruher Richter begründen dies ausführlich und heben wesentliche Unterschiede zwischen Anwaltsleistungen und z.B. Handwerkerleistungen hervor:
- Unklare Kosten im Voraus: Bei rechtlichen Auseinandersetzungen lassen sich Gesamtkosten schwer vorhersagen. Die Dauer des Verfahrens, mögliche Instanzenzüge oder ein Vergleich – all das beeinflusst die Anwaltskosten. Ein Preisvergleich im Voraus ist daher wenig aussagekräftig.
- Keine garantierte Erfolgspflicht: Ein Rechtsanwalt schuldet keinen konkreten Erfolg, sondern eine „ergebnisoffene“ Dienstleistung. Anders als ein Handwerker, der einen fest umrissenen Mangel beseitigt, kann man die Qualität anwaltlicher Arbeit nicht vorab genau messen oder vergleichen. Angebote verschiedener Kanzleien würden den Eigentümern keinen echten Aufschluss über die späteren Ergebnisse liefern.
- Vertrauensverhältnis zählt: Die persönliche Beziehung und das Vertrauen zwischen Mandant und Anwalt sind entscheidend. Dieser „Chemie“-Faktor lässt sich durch keinen Angebotsvergleich abbilden. Jeder Eigentümer kennt das – bei rechtlichen Problemen möchte man einen kompetenten und vertrauenswürdigen Rechtsbeistand, nicht zwingend den billigsten.
Der BGH betont, dass der Zweck von Konkurrenzangeboten eigentlich darin liegt, Stärken und Schwächen von Leistungsangeboten transparent zu machen. Bei Handwerkeraufträgen mag das funktionieren (Leistungsumfang, Preis, Garantien etc. sind vergleichbar). Bei Anwaltsmandaten hingegen verfehlt ein solcher Angebotsvergleich seinen Zweck von vornherein. Die Einholung von Alternativangeboten würde den Wohnungseigentümern keinen wesentlichen Erkenntnisgewinn bringen – weder hinsichtlich der Kosten noch der Qualität der Anwälte. Daher ist es nicht erforderlich und gehört nicht zur ordnungsmäßigen Verwaltung, vor der Anwaltsbeauftragung Angebote einzuholen.
Wirtschaftlichkeit und angemessene Vergütung
Ein wichtiger Aspekt für WEG-Entscheidungen ist stets das Gebot der Wirtschaftlichkeit. Man könnte befürchten, der Verzicht auf Vergleichsangebote öffne überteuerten Honoraren Tür und Tor. Doch der BGH gibt Entwarnung: Die Eigentümer müssen zwar wirtschaftlich denken, dürfen aber Kosten und Nutzen selbst abwägen. Im konkreten Fall hielt der BGH einen Stundensatz von 300 € für Anwälte und 150 € für Kanzleipersonal angesichts der Komplexität und Dringlichkeit der Sache für vertretbar. Hier spielte auch die Spezialisierung der Kanzlei eine Rolle – Expertise darf etwas kosten.
Zudem erinnert der BGH an Schutzmechanismen im Recht der Anwaltsvergütung: Nach § 3a Abs. 3 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) kann ein Gericht eine unangemessen hohe Vergütung auf die übliche gesetzliche Gebühr herabsetzen. Anders gesagt: Selbst wenn keine Vergleichsangebote eingeholt wurden und eine hohe Honorarvereinbarung abgeschlossen wird, sind die Wohnungseigentümer nicht schutzlos gestellt. Extrem überhöhte Anwaltshonorare könnten im Streitfall von Gerichten korrigiert werden. In der Praxis kommt so etwas aber selten vor – die meisten Anwälte vereinbaren Honorare innerhalb eines angemessenen Rahmens.
Nachträgliche Genehmigung durch die WEG – was ist erlaubt?
Der Fall vor dem BGH betraf auch die Frage, ob die WEG eine ohne Beschluss vorab erfolgte Beauftragung (durch die Verwalterin) nachträglich genehmigen darf. Seit der WEG-Reform 2020 hat der Verwalter im Außenverhältnis ohnehin weitreichende Vertretungsmacht (§ 9b Abs. 1 WEG). Er kann also – etwa bei dringenden Maßnahmen – im Namen der Gemeinschaft handeln, selbst wenn die Eigentümerversammlung noch nicht beschließen konnte. Die spätere Beschlussfassung dient vor allem der internen Willensbildung und klaren Finanzierung.
Der BGH stellt klar: Es liegt im Ermessen der Wohnungseigentümer, eine vom Verwalter veranlasste Maßnahme nachträglich zu genehmigen, sofern diese an sich ordnungsmäßiger Verwaltung entspricht. Im entschiedenen Fall war das gegeben (die Sicherung von Gewährleistungsansprüchen durch Gutachter und Anwalt lag im Interesse der Gemeinschaft). Die Beschlüsse, mit denen die Eigentümer die Vergabe im Nachhinein billigten, waren daher rechtmäßig.
Für die Praxis heißt das: Verwalter dürfen in Eilfällen handeln, sollten dies aber später transparent machen und von den Eigentümern absegnen lassen. Eigentümer wiederum können solchen Dringlichkeitsentscheidungen im Nachhinein zustimmen, wenn die Maßnahme vernünftig und notwendig war. Dieses Vorgehen schafft Rechtssicherheit und verhindert, dass Ansprüche der Gemeinschaft verloren gehen, nur weil formell noch kein Beschluss vorlag.
Was Wohnungseigentümer und Verwalter jetzt wissen sollten
Das BGH-Urteil bringt erleichternde Klarheit für Wohnungseigentümergemeinschaften und Verwalter. Nachfolgend die wichtigsten Punkte und Tipps im Überblick:
- Freie Anwaltswahl: Die Gemeinschaft kann ihren Wunsch-Anwalt direkt beauftragen, ohne vorher Angebote von anderen Kanzleien einholen zu müssen. Die Entscheidung für einen Rechtsanwalt ist Vertrauenssache – Kompetenz, Spezialisierung und ein gutes Gefühl dürfen den Ausschlag geben, nicht nur der Preis.
- Keine Anfechtung allein wegen fehlender Angebote: Eigentümer, die mit dem Beschluss nicht einverstanden sind, können nicht mehr allein mit dem Argument fehlender Vergleichsangebote eine Anfechtung begründen. Ein Beschluss ist nicht unwirksam, nur weil die WEG nur ein Angebot (das des ausgewählten Anwalts) vorliegen hatte. Wichtig ist vielmehr, dass die Beauftragung als solche sinnvoll und im Gemeinschaftsinteresse liegt.
- Dennoch Kosten im Blick behalten: Auch wenn kein förmlicher Preisvergleich nötig ist, sollten Verwalter und Beiräte natürlich darauf achten, dass das Honorar im Rahmen bleibt. Wucherpreise sind unzulässig – im Zweifel greift § 3a RVG und das Gericht würde ein völlig überhöhtes Honorar auf das Angemessene reduzieren. Im Regelfall empfiehlt es sich, vor Vertragsschluss über die Vergütung zu sprechen und ggf. eine schriftliche Honorarvereinbarung zu treffen, damit alle Eigentümer wissen, was finanziell auf sie zukommt.
- Dringlichkeit vs. Formalien: Gibt es dringende Gründe (z.B. Fristablauf, Verjährung), darf der Verwalter sofort einen Anwalt einschalten, um Schaden von der Gemeinschaft abzuwenden. Die erforderlichen Beschlüsse können dann nachträglich in der nächsten Eigentümerversammlung gefasst werden. Diese Genehmigung im Nachhinein ist zulässig, wenn die Maßnahme an sich gerechtfertigt war. Verwalter sollten die Eigentümer über solche Schritte umgehend informieren.
- Abgrenzung zu anderen Fällen: Achtung – dieses Urteil gilt speziell für Rechtsanwälte (und vergleichbar für Sachverständige). Bei anderen Dienstleistungen oder Aufträgen, vor allem größeren Bau- und Reparaturmaßnahmen, bleibt es grundsätzlich dabei, dass mehrere Angebote sinnvoll oder sogar nötig sein können, um die wirtschaftlich beste Entscheidung zu treffen. Die Verwaltungspraxis sollte also nicht völlig geändert werden: Wo ein echter Leistungsvergleich möglich ist (z.B. bei Handwerkern, Hausverwaltungsverträgen), sind Vergleichsangebote weiterhin Best Practice und oft vom Grundsatz ordnungsmäßiger Verwaltung gedeckt.
Zusammengefasst: Wohnungseigentümer und Verwalter können in Zukunft mit mehr Vertrauen vorgehen, wenn es um die Einschaltung eines Anwalts geht. Fachkenntnis, Spezialisierung und persönliches Vertrauen dürfen bei der Anwaltswahl im Vordergrund stehen, ohne Angst vor Formfehlern. Das BGH-Urteil bestätigt: Die Gemeinschaft ist handlungsfähig, auch spontan bei Eilbedürftigkeit, und darf darauf vertrauen, dass der gewählte Rechtsbeistand im besten Interesse aller Eigentümer handelt – selbst wenn man nicht den günstigsten Anbieter im Wettbewerb gewählt hat. Diese Klarstellung schafft Rechtssicherheit und erleichtert die Zusammenarbeit von WEG und Rechtsanwälten erheblich.
Praktische Handlungsempfehlungen
Zum Abschluss noch ein paar praktische Tipps für den Alltag in der Wohnungseigentümergemeinschaft, um das neue BGH-Urteil umzusetzen:
- Vertrauensanwalt auswählen: Setzen Sie auf einen Rechtsanwalt Ihres Vertrauens, idealerweise mit Erfahrung im WEG-Recht oder dem spezifischen Problem der Gemeinschaft. Die Chemie und das Vertrauen stimmen? Dann fühlen Sie sich frei, diesen Anwalt vorzuschlagen – Preisvergleiche sind nicht zwingend erforderlich.
- Transparenz gegenüber den Eigentümern: Auch ohne Pflicht zur Konkurrenz-Angebotseinholung ist offene Kommunikation Informieren Sie die Eigentümer, warum gerade diese Kanzlei empfohlen wird (z.B. Spezialist für Baurecht, hat die Anlage vielleicht schon beraten etc.). So schaffen Sie Vertrauen innerhalb der Gemeinschaft und vermeiden unnötige Diskussionen über „Warum haben wir nicht erst andere gefragt?“.
- Honorarvereinbarung prüfen: Lassen Sie sich vom Anwalt eine Honorarvereinbarung geben oder zumindest die voraussichtliche Gebührenstruktur erklären. 300 € pro Stunde mögen in komplexen Fällen angemessen sein, aber jeder soll wissen, worauf man sich einlässt. Ggf. kann man auch Deckelungen oder Pauschalen Denken Sie daran: Überzogene Honorare sind angreifbar, und das Gesetz bietet Korrektive.
- Dringende Fälle sofort angehen: Bei drohenden Fristen oder Notfällen sollte die Devise lauten: Handeln, nicht zögern. Der Verwalter kann und sollte sofort einen passenden Anwalt einschalten, um Schäden abzuwenden. Holen Sie die Zustimmung der Eigentümer so bald wie möglich nachträglich ein, am besten auf der nächsten Versammlung. Dokumentieren Sie die Gründe für das sofortige Tätigwerden (z.B. Gutachterkosten wegen Verjährung) für das Protokoll.
- Weiterhin Wirtschaftlichkeit beachten: Auch wenn kein Bieterwettbewerb nötig ist, bleiben Sie kostenbewusst. Fragen Sie den Anwalt ruhig, ob seine Stundensätze üblich sind und ob es günstigere Alternativen gibt (z.B. bestimmte Aufgaben an einen Junior-Anwalt oder Spezialisten delegieren). Die Eigentümergemeinschaft darf Kosten und Nutzen abwägen – manchmal ist ein höherer Preis für erstklassige Arbeit gerechtfertigt, aber Transparenz schafft Akzeptanz.
- Grenzen kennen: Denken Sie daran, dass dieses Urteil kein Freibrief für alle Fälle ist. Bei anderen Projekten (etwa großen Instandsetzungen) bleiben Vergleichsangebote sinnvoll oder vorgeschrieben. Nutzen Sie den gewonnenen Spielraum also gezielt für Rechts- und Beratungsdienstleistungen, wo Vertrauen und Qualität wichtiger sind als der letzte Cent beim Preis.
Mit diesen Empfehlungen im Hinterkopf können Wohnungseigentümer und Verwalter das BGH-Urteil von 2025 souverän in die Praxis umsetzen. Fazit: Vertrauen Sie auf Ihren Rechtsbeistand und treffen Sie fundierte Entscheidungen – die Rechtslage ist jetzt auf Ihrer Seite, wenn es darum geht, schnell und effektiv rechtliche Hilfe für die Gemeinschaft zu organisieren. Bleiben Sie transparent und vernünftig bei den Kosten, dann steht einer erfolgreichen Interessenvertretung der Gemeinschaft nichts im Wege.