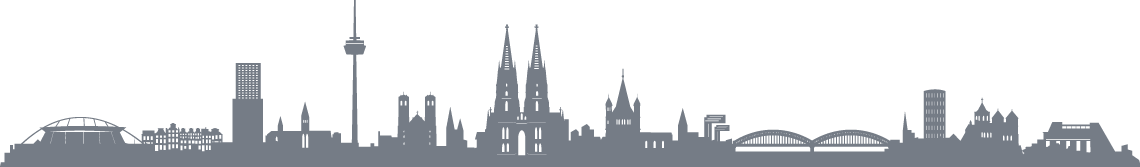Hintergrund: Eigenbedarf vs. Verwertungskündigung
Nach deutschem Mietrecht darf ein Vermieter ein unbefristetes Wohnraummietverhältnis nur kündigen, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Beendigung hat (§ 573 Abs. 1 BGB). Am häufigsten geschieht dies wegen Eigenbedarfs (§ 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB) – der Vermieter benötigt die Wohnung, um sie für sich selbst, Familienangehörige oder Haushaltsangehörige zu nutzen. Eine weitere Variante ist die Verwertungskündigung (§ 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB), bei der der Vermieter wegen angemessener wirtschaftlicher Verwertung kündigen darf, wenn ihm die Fortsetzung des Mietverhältnisses diese Verwertung erheblich erschweren würde.
Eigenbedarfskündigung: Hier genügt grundsätzlich der ernsthafte Wunsch des Vermieters, die Wohnung künftig selbst (oder durch privilegierte Personen) zu nutzen. Der Vermieter muss nicht nachweisen, dass er ohne diese Wohnung obdachlos wäre oder keinen anderen Wohnraum hat. Entscheidend ist, dass seine Gründe vernünftig und nachvollziehbar sin. Die Gerichte dürfen dem Vermieter nicht vorschreiben, was in seinen Lebensumständen als “angemessenes Wohnen” zu gelten hat. Allerdings prüfen Gerichte einen Eigenbedarf auf Vorschützen oder Rechtsmissbrauch: Etwa, wenn der Bedarf offensichtlich vorgeschoben ist, die gewünschte Nutzung gar nicht möglich wäre oder alternative freie Wohnungen des Vermieters den Bedarf decken könnten, kann eine Kündigung unwirksam sein.
Verwertungskündigung: Diese kommt zur Anwendung, wenn der Vermieter z.B. die Mietwohnung verkaufen oder baulich verändern möchte und durch das bestehende Mietverhältnis an einer sinnvollen Verwertung gehindert ist. Die Hürden hierfür sind hoch – ein bloßes Gewinnstreben („Renditeinteresse“) reicht nicht. Vielmehr muss die fortgesetzte Vermietung die wirtschaftliche Nutzung erheblich beeinträchtigen. Klassische Fälle sind etwa geplante Abriss-/Neubauvorhaben oder Verkäufe in Eigentumswohnungen, bei denen der Mieterschutz einer angemessenen Verwertung entgegensteht. Aufgrund der restriktiven Voraussetzungen wird die Verwertungskündigung in der Praxis selten erfolgreich durchgesetzt.
Der Fall: Vermieter plant Umbau und Wohnungsverkauf
In einem aktuellen Fall aus Berlin, der bis zum Bundesgerichtshof (BGH) gelangte, stellte sich die Frage, welcher Kündigungsgrund vorliegt: Ein Vermieter wohnte selbst im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, direkt eine Etage über der Mieterin, der er kündigte. Beide Wohnungen waren ähnlich groß und geschnitten. Plan des Vermieters: Er wollte das Dachgeschoss ausbauen und mit seiner eigenen Wohnung im 4. Stock verbinden, um diese vergrößerte Einheit anschließend gewinnbringend zu verkaufe. Für die mehrmonatigen Umbauarbeiten stünde ihm seine Wohnung nicht zur Verfügung, daher kündigte er der Mieterin im 3. Stock wegen Eigenbedarfs, um diese Wohnung als Ausweichquartier zu nutzen – und zwar nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft. Nach Fertigstellung des Ausbaus beabsichtigte er, in der Drittstockwohnung zu bleiben und die ausgebaute Dachgeschoss-Vierten-Stock-Wohnung zu veräußern.
Verlauf vor Gericht: Das Amtsgericht Charlottenburg gab der Eigenbedarfskündigung zunächst statt – es erkannte den Nutzungswillen des Vermieters an. Auf Berufung der Mieterin jedoch wies das Landgericht Berlin die Klage ab. Aus Sicht des Landgerichts lag kein echter Eigenbedarf vor, sondern eine unzulässige Verwertungskündigung, da der Vermieter letztlich nur einen optimalen Verkaufspreis für seine Eigentumswohnung erzielen wolle. Der vorhandene Wohnbedarf des Vermieters sei in seiner bisherigen Wohnung bereits gedeckt; die Kündigung allein zur Gewinnoptimierung sei nicht vom Eigenbedarfsrecht gedeckt, so das Landgericht. Mit anderen Worten: Der Vermieter habe den Bedarf nur vorgeschoben, um seine Wohnung lukrativ verwerten zu können, was nach § 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB aber an strenge Voraussetzungen geknüpft ist, die hier nicht erfüllt waren.
Entscheidung des BGH: Erweiterter Eigenbedarfsbegriff
Der BGH (Urteil vom 24.09.2025 – VIII ZR 289/23) hob das Berufungsurteil auf und stellte wichtige Klarstellungen zum Eigenbedarfsbegriff und zur Abgrenzung zur Verwertungskündigung heraus. Kernaussagen des BGH:
- Selbst herbeigeführter Bedarf: Auch wenn der Vermieter seinen Wohnbedarf willentlich selbst geschaffen oder „selbst verursacht“ hat – etwa durch die Entscheidung, seine eigene Wohnung umzubauen und zu verkaufen – kann daraus trotzdem ein legitimer Eigenbedarf entstehen. Entscheidend ist, dass der Wunsch, die bisher vermietete Wohnung nun selbst zu beziehen, ernsthaft und plausibel begründet ist.
- Keine strenge Notwendigkeit erforderlich: Das Gesetz verlangt nicht, dass der Vermieter „zwingend“ auf die Wohnung angewiesen ist. Ausreichend ist ein vernünftiger, nachvollziehbarer Wunsch, die Wohnung selbst zu nutzen. Hier betonte der BGH erneut den weiten Spielraum des Vermieters bei der Gestaltung seiner Wohnverhältnisse. Solange sein Nutzungswunsch authentisch ist, darf er auch individuelle Wohnvorstellungen haben (z.B. Zusammenlegung von Räumen, Verkleinerung oder Vergrößerung des Wohnbereichs usw.), ohne dass Gerichte dies als „unnötig“ abtun dürfen. Gerichte sind nicht berechtigt, ihre eigenen Maßstäbe für angemessenes Wohnen an die Stelle der Lebensplanung des Vermieters zu setzen.
- Unveränderte Wohnsituation irrelevant: Dass sich die Wohnverhältnisse des Vermieters durch den Umzug kaum verändern (weil die Ersatzwohnung ähnlich groß und geschnitten ist), spielt keine Rolle. Ein Vermieter darf auch dann eine andere Wohnung im Haus für sich beanspruchen, wenn diese objektiv keinen größeren Komfort oder Raumgewinn bietet. Selbst eine Verkleinerung oder lateral verschobene Nutzung ist legitim, sofern es seinem persönlichen Wohnkonzept entspricht.
- Gewinnabsicht allein macht noch keine Verwertungskündigung: Der Wunsch, durch Verkauf der bisherigen Wohnung einen Gewinn zu erzielen, entwertet den Kündigungsgrund nicht automatisch. Entscheidend war hier: Der Vermieter wollte nicht die Mietwohnung der Mieterin verkaufen, sondern eine andere Wohnung in seinem Eigentum (nämlich die ausgebaute Dachgeschosswohnung) – dies fällt unter Eigenbedarf, nicht unter Verwertungskündigung. Eine Verwertungskündigung (§ 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB) wäre nur einschlägig, wenn gerade die vermietete Wohnung verwertet werden soll und das Mietverhältnis die Verwertung behindert. Das war hier nicht der Fall, da die Verwertung (Verkauf) sich auf die andere Wohneinheit bezog, die der Vermieter ohne Kündigung der Mieterin nicht in der geplanten Form hätte schaffen können. Der BGH sah „keinen Raum für die Annahme einer rechtsmissbräuchlichen Umgehung“ der Verwertungskündigungsregeln.
Zusammengefasst hat der BGH also den Eigenbedarfsbegriff großzügig ausgelegt: Solange der Vermieter tatsächlich vorhat, die gekündigte Wohnung selbst zu beziehen und dieser Entschluss nachvollziehbaren persönlichen Motiven folgt, bleibt es eine Eigenbedarfskündigung, selbst wenn im Hintergrund wirtschaftliche Überlegungen (wie ein geplanter Immobilienverkauf anderweitig im Haus) eine Rolle spielen.
Allerdings bedeutet dies nicht den automatischen Sieg des Vermieters. Der BGH hat den Fall an eine andere Kammer des Landgerichts zurückverwiesen. Dort muss nun geprüft werden, ob im konkreten Einzelfall der geltend gemachte Eigenbedarf tatsächlich besteht und von ernsthaften, vernünftigen und nachvollziehbaren Gründen getragen ist. Mit anderen Worten: Das Berufungsgericht muss nun die Ehrlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Umzugs- und Nutzungsplans des Vermieters genau untersuchen. Beispielsweise könnte relevant sein, ob der Vermieter den Plan schon weit vorbereitet hat (Baupläne, Finanzierungen, etc.) und ob er tatsächlich dauerhaft in die ehemals vermietete Wohnung ziehen will. Sollte sich herausstellen, dass der Vermieter etwa doch andere Absichten hat oder der angebliche Nutzungswunsch nur vorgeschoben war, wäre die Kündigung trotz BGH-Grundsätzen unwirksam – das bleibt im neuen Berufungsverfahren zu klären.
Bedeutung für Vermieter
Für Vermieter stärkt dieses Urteil tendenziell die Rechte bei Eigenbedarfskündigungen. Einige wichtige Praxishinweise für Vermieter lassen sich daraus ableiten:
- Ausgeweiteter Eigenbedarf: Sie dürfen auch dann wegen Eigenbedarfs kündigen, wenn die Entscheidung dazu aus langfristigen Wohnplänen oder Umgestaltungen resultiert, die Sie selbst initiiert haben. Eine selbst herbeigeführte Änderung der Lebensplanung (z.B. Umbau, Verkauf einer anderen Wohnung) schließt den Eigenbedarf nicht aus. Wichtig ist aber, dass Sie tatsächlich beabsichtigen, die Mietwohnung selbst zu nutzen – sei es als Übergangswohnung während Umbauten und anschließend dauerhaft, oder weil Sie generell Ihren Wohnraum neu ordnen möchten.
- Kündigungsschreiben sorgfältig begründen: Legen Sie im Kündigungsschreiben transparent und ausführlich die Gründe dar. Nach § 573 Abs. 3 BGB müssen Vermieter den Kündigungsgrund ohnehin im Kündigungsschreiben angeben. Erklären Sie, wer einziehen soll (Sie selbst, ein Familienangehöriger, etc.) und warum die Eigenbedarfssituation besteht. Im vorliegenden Fall nannte der Vermieter z.B. konkret den Dachausbau und Verkauf seiner bisherigen Wohnung als Grund dafür, dass er die Mieterwohnung benötig. Diese konkrete Darlegung half, den Eigenbedarfswunsch als nachvollziehbar erscheinen zu lassen. Unklare oder pauschale Begründungen sollte man vermeiden – sie wecken Misstrauen und können die Kündigung anfechtbar machen.
- Kein Missbrauch anderer Kündigungsgründe: Überlegen Sie gut, ob wirklich Eigenbedarf einschlägig ist. Wenn Ihr eigentliches Ziel die Verwertung der Mietwohnung selbst ist (z.B. Verkauf der vermieteten Wohnung frei von Mietern, umfassende Luxussanierung zur Mieterhöhung, Abriss des vermieteten Gebäudes), dann müssen die Voraussetzungen der Verwertungskündigung erfüllt sein. Diese sind strenger und erfordern oft den Nachweis einer erheblichen wirtschaftlichen Beeinträchtigung durch den Fortbestand des Mietverhältnisses. Versuchen Sie nicht, eine Verwertungskündigung als „Eigenbedarf“ zu tarnen – kommt dies heraus, wird das Gericht die Kündigung wegen Rechtsmissbrauchs kippen.
- Nachweisbarer Plan: Seien Sie darauf vorbereitet, Ihren Nutzungswillen im Zweifel zu beweisen. Im Prozess müssen Sie plausibel machen, dass Sie ernsthaft vorhaben, in die Wohnung einzuziehen und Ihre Pläne umzusetzen. Dokumente (z.B. Baupläne, Finanzierung für Umbau, Inseratvorbereitung für Verkauf der alten Wohnung etc.) können helfen, den Eigenbedarf zu untermauern. Denken Sie auch daran: Zieht der Vermieter nach Kündigung nicht innerhalb angemessener Zeit wie angekündigt ein oder verkauft statt der Eigenutzung die Wohnung doch an Dritte, kann der ehemalige Mieter Schadenersatz wegen vorgetäuschten Eigenbedarfs fordern. Das heißt, es ist in Ihrem eigenen Interesse, den im Kündigungsschreiben angegebenen Nutzungsplan dann auch zu realisieren.
- Fristen einhalten: Beachten Sie bei der Kündigung die gesetzlichen Kündigungsfristen, die je nach Mietdauer zwischen 3 und 9 Monaten liegen (§ 573c BGB). Im obigen Fall kündigte der Vermieter im November 2021 zum Juli 2022 – das entsprach der gesetzlichen Frist von 9 Monaten bei langer Mietdauer (hier Mietverhältnis seit 2006). Formfehler oder Fristfehler können eine an sich berechtigte Kündigung sonst zunichtemachen.
Bedeutung für Mieter
Auch Mieter sollten die Implikationen dieses Urteils kennen, um ihre Rechte besser einschätzen zu können:
- Weit gefasster Eigenbedarf: Seien Sie sich bewusst, dass Eigenbedarfskündigungen gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbar sind. Ein Vermieter muss keinen „Notfall“ nachweisen – es genügt ein legitimer Wohnwunsch. Selbst wenn Ihnen die Begründung auf den ersten Blick eher wie ein wirtschaftliches Interesse erscheint (z.B. der Vermieter will in Ihre Wohnung ziehen, um seine eigene teuer verkaufen zu können), kann dies rechtlich als Eigenbedarf anerkannt sein. Das aktuelle BGH-Urteil zeigt, dass Gerichte dem Eigentumsrecht des Vermieters und dessen Selbstnutzungsinteresse hohen Stellenwert beimessen.
- Prüfen Sie die Kündigung genau: Erhalten Sie eine Eigenbedarfskündigung, lesen Sie die Begründung sorgfältig. Diese muss plausible Angaben enthalten, wer einziehen will und warum. Fehlen konkrete Angaben oder klingt der Grund fragwürdig, sollten Sie das hinterfragen. Beispielsweise: Kündigt ein Vermieter wegen Eigenbedarfs, obwohl ihm im selben Haus eine vergleichbare Wohnung bereits frei steht, kann das ein Indiz für Vortäuschung sein. Im beschriebenen Fall wohnte der Vermieter zwar im selben Haus, hatte aber keine andere freie Wohnung verfügbar – sein Begehren richtete sich gerade auf die von Ihnen bewohnte Einheit.
- Recht auf Widerspruch wegen Härte: Ihr stärkster Schutz ist der Sozialaspekt gemäß § 574 BGB (Widerspruch wegen unzumutbarer Härte). Unabhängig davon, ob der Eigenbedarf berechtigt ist, können Sie der Kündigung innerhalb von 2 Monaten nach Zugang widersprechen, wenn der Auszug für Sie eine unzumutbare Härte bedeuten würde. Härtegründe können hohes Alter, schwere Krankheit, Schwangerschaft, fehlender Ersatzwohnraum trotz intensiver Suche oder tiefgreifende Verwurzelung in der Wohnung/im Wohnumfeld sein. Diese muss das Gericht dann gegen das Vermieterinteresse abwägen. Beachten Sie: Dies ist kein Automatismus – Sie müssen den Härtefall aktiv geltend machen und idealerweise belegen (z.B. Atteste, Nachweise erfolgloser Wohnungssuche etc.). Im BGH-Fall war ein Härteeinwand offenbar nicht (mehr) streitig; dort ging es primär um die Frage, ob die Kündigung an sich zulässig war. Doch in vergleichbaren Fällen kann ein Härteeinwand der Mieterin/dem Mieter ggf. dennoch zum Verbleib in der Wohnung führen, selbst wenn Eigenbedarf vorliegt.
- Achtung vor vorgetäuschtem Eigenbedarf: Falls Sie ausziehen mussten und Zweifel an der Ehrlichkeit des Eigenbedarfs haben, behalten Sie die weitere Entwicklung im Auge. Zieht der Vermieter – oder die benannte Person – nicht wie angekündigt ein, oder wird die Wohnung zeitnah nach Ihrem Auszug anderweitig vermietet oder verkauft, sollten Sie rechtlichen Rat suchen. Ihnen könnte dann ein Schadensersatzanspruch zustehen (z.B. Umzugskosten, Maklerkosten für neue Wohnung, eventuelle erhöhte Miete anderswo). Der Vermieter macht sich nämlich schadensersatzpflichtig, wenn er den Eigenbedarf nur vorgeschoben hat. Gerichte prüfen im Nachhinein streng, ob der behauptete Bedarf tatsächlich umgesetzt wurde oder nicht.
- Unterstützung suchen: Eigenbedarfskündigungen sind für viele Mieter einschüchternd. Zögern Sie nicht, Mietervereine oder Rechtsberatung einzuschalten. Gerade in Städten wie Berlin gibt es Mietervereine, die solche Fälle häufig begleiten – im vorliegenden Urteil hat z.B. der Berliner Mieterverein die Entscheidung scharf kritisiert und fordert gesetzliche Reformen, um Kündigungen aus Renditeinteressen zu erschweren. Die politische Diskussion zeigt, dass das Thema Eigenbedarf im Wandel ist, aber bis zu etwaigen Gesetzesänderungen gelten die aktuellen Regelungen und Gerichtsentscheidungen.
Das BGH-Urteil vom 24. September 2025 (VIII ZR 289/23) verdeutlicht, dass Vermieter ihren Wohnungszuschnitt auch auf Kosten eines Mieters verändern dürfen, solange ein plausibler Eigennutzungswunsch dahintersteht. Die Gerichte sind angehalten, den Eigentumsrechten der Vermieter und deren Lebensplanung Rechnung zu tragen. Für Vermieter bedeutet dies Erleichterung in Spezialfällen wie Umbau mit anschließender Veräußerung einer anderen Wohnung: Solche Pläne können Eigenbedarf begründen, wenn der Vermieter die Mietwohnung tatsächlich selbst beziehen will. Für Mieter hingegen ist dies ein Weckruf, dass Eigenbedarf sehr weit gehend anerkannt wird – selbst dann, wenn im Spiel des Vermieters finanzielle Motive erkennbar sind.
Dennoch bleibt jeder Fall individuell: Vermieter sollten ihre Eigenbedarfskündigung wasserdicht begründen und fair handeln, Mieter ihre Abwehrrechte (Widerspruch, Prüfung auf Missbrauch) kennen. Im Idealfall sucht man frühzeitig das Gespräch: Eventuell lässt sich eine einvernehmliche Lösung finden, z.B. mit Umzugshilfen oder einer Verlängerung der Wohnzeit für den Mieter. So lassen sich Härten vermeiden. Am Ende zeigt das Urteil vor allem eines: Die Rechte aus Eigentum und Mieterschutz stehen in einem ständigen Spannungsfeld – der BGH versucht hier, eine ausgewogene Balance zu wahren, indem legitimer Eigennutz des Vermieters anerkannt, aber gleichzeitig die Anforderungen an Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit hoch gehalten werden.