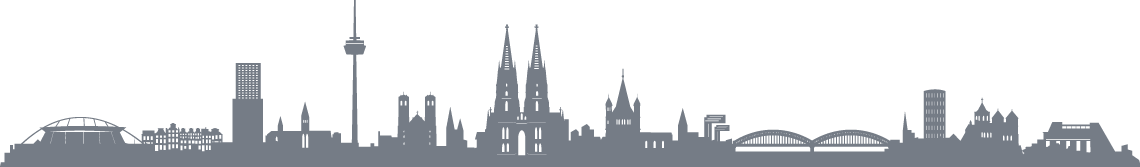Wenn ein Makler Mietinteressenten mit ausländisch klingenden Namen systematisch von Wohnungsbesichtigungen ausschließt, kann darin eine verbotene Diskriminierung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) liegen. In einem aktuellen Fall, der nun vom Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt wird, soll genau dies geschehen sein. Eine Wohnungssuchende mit pakistanischem Namen erhielt auf ihre Besichtigungsanfragen stets Absagen – während unter identischen Bedingungen gestellte Anfragen mit deutsch klingenden Namen sofort zu Besichtigungsterminen führten. Die Betroffene fühlt sich aufgrund ihrer ethnischen Herkunft benachteiligt und klagte auf Entschädigung nach dem AGG. Dieser Fall wirft wichtiges Licht auf die Rechte von Mietinteressenten sowie die Pflichten von Vermietern und Maklern, diskriminierungsfrei zu handeln.
Sachverhalt des BGH-Falls
Im November 2022 bewarb sich die Klägerin, deren Vor- und Nachname pakistanisch klingen, mehrfach online um Besichtigungstermine für eine vom Beklagten (einem Immobilienmakler) angebotene Wohnung. Sie erhielt jedes Mal eine Absage. Um einen möglichen Diskriminierungsverdacht zu überprüfen, führte die Mietinteressentin so genanntes Situation-Testing durch:
- Weitere Anfragen mit ausländisch klingenden Namen: Sowohl die Klägerin selbst als auch von ihr beauftragte Personen schickten zusätzliche Besichtigungsanfragen unter verschiedenen ausländisch klingenden Namen – jedoch mit denselben Angaben zu Einkommen, Beruf und Haushaltsgröße. Ergebnis: Ausnahmslos alle diese Anfragen blieben erfolglos; es gab keine Besichtigungseinladungen.
- Vergleichsanfragen mit deutsch klingenden Namen: Anschließend stellte die Klägerin (bzw. Beauftragte in ihrem Namen) identische Anfragen unter Namen wie „Schneider“, „Schmidt“ und „Spieß“. Ergebnis: Hier erhielten alle prompt eine Einladung zu einem Besichtigungstermin.
Diese deutliche Diskrepanz legt den Schluss nahe, dass allein der Name bzw. die vermutete ethnische Herkunft der Bewerberin für die Absagen ausschlaggebend war. Die Klägerin behauptet, sie sei aufgrund ihres Namens (als Merkmal ihrer ethnischen Herkunft) benachteiligt worden. Sie berief sich auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und verlangte vom Makler eine angemessene Entschädigung für die erlittene Diskriminierung sowie die Erstattung ihrer vorgerichtlichen Anwaltskosten.
Bisheriger Prozessverlauf: Amtsgericht und Landgericht
In erster Instanz vor dem Amtsgericht Groß-Gerau hatte die Klage zunächst keinen Erfolg – das Gericht wies die Forderung der Mietinteressentin ab. Die genauen Gründe des Amtsgerichts sind nicht detailliert bekannt, vermutlich wurde entweder ein ausreichender Nachweis der Diskriminierung verneint oder die Verantwortlichkeit des Maklers infrage gestellt. Solche erstinstanzlichen Entscheidungen fallen jedoch gelegentlich sehr restriktiv aus, was dazu führen kann, dass berechtigte Ansprüche im ersten Anlauf scheitern.
Die Klägerin legte Berufung ein – mit Erfolg. Das Landgericht Darmstadt änderte das Urteil ab und gab der Klage statt: Der Makler wurde verurteilt, an die abgelehnte Mietinteressentin 3.000 € Entschädigung zu zahlen sowie die vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten zu erstatten. Nach Auffassung des Landgerichts lagen hier hinreichende Indizien (§ 22 AGG) vor, die eine Benachteiligung wegen der ethnischen Herkunft vermuten lassen. Insbesondere sei es ausgeschlossen, dass rein zufällig sämtliche Anfragen unter pakistanischen Namen negativ beschieden wurden, während gleichzeitig alle Anfragen unter typisch deutschen Namen positiv beantwortet wurden – ohne dass eine Benachteiligung im Sinne des AGG vorliegt. Ein derart klares Muster spricht für das Gericht eine deutliche Sprache. Der Beklagte konnte keinen plausiblen, nicht-diskriminierenden Grund für dieses Verhalten darlegen und auch keine rechtmäßige Ausnahme vom Gleichbehandlungsgebot aufzeigen. Insbesondere wurden keine Umstände nach § 19 Abs. 3 AGG vorgetragen, die eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen könnten (diese Vorschrift lässt z.B. in engen Grenzen Ungleichbehandlungen zur Wahrung sozial stabiler Bewohnerstrukturen zu – dazu unten mehr).
Bemerkenswert ist, dass das Landgericht auch die Maklerrolle klar einordnete: Nicht nur die jeweiligen Vermieter (Wohnungseigentümer) unterliegen dem Benachteiligungsverbot des § 19 AGG, sondern hier auch der Makler selbst. Da die Vermieter dem Makler bei der Auswahl der Interessenten freie Hand gelassen hatten, war auch er als Vermittler unmittelbar an das Diskriminierungsverbot gebunden. Mit anderen Worten: Ein Immobilienmakler darf bei der Vorselektion von Mietern keine unzulässigen Diskriminierungen vornehmen – tut er es dennoch, macht er sich selbst haftbar.
Gegen das Urteil des Landgerichts hat der Makler Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt (Az. I ZR 129/25). Der für das Maklerrecht unter anderem zuständige I. Zivilsenat des BGH muss nun entscheiden, ob das Berufungsurteil Bestand hat. Die Entscheidung des BGH steht zum Zeitpunkt dieses Rechtstipps noch aus. Sie wird voraussichtlich klären, ob die vom Landgericht vertretene Rechtsauffassung – insbesondere zur Haftung des Maklers und zur Beweiserleichterung durch Testing – bestätigt wird. Für die Praxis aller Beteiligten am Wohnungsmarkt ist das von großer Bedeutung.
Rechtliche Grundlagen: Diskriminierungsverbot im Wohnungsmarkt
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) schützt Menschen vor Diskriminierung auch auf dem Wohnungsmarkt. § 1 AGG nennt als Ziel, „Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.“ Dieser Diskriminierungsschutz gilt ausdrücklich auch bei Mietwohnungsverhältnissen – also bei der Wohnungsvermittlung und -vermietung. Niemand darf bei der Wohnungssuche aufgrund der genannten Merkmale benachteiligt werden.
Allerdings kennt das Gesetz einige Ausnahmen. Wichtig ist: Für die Merkmale „Rasse“ und ethnische Herkunft – worunter die vorliegende Diskriminierung wegen eines pakistanischen Namens fällt – gelten keine Einschränkungen; hier greift der Schutz unabhängig von der Größe des Vermieters und praktisch in allen Wohnungsangeboten. Andere Merkmale (z.B. Religion oder Weltanschauung, Alter, Geschlecht) sind im Mietrecht erst dann umfassend geschützt, wenn die Vermieterin mehr als 50 Wohnungen vermietet (§ 19 Abs. 5 S.3 AGG). Ein privater Kleinvermieter mit nur einer oder wenigen Wohnungen könnte also z.B. bei der Auswahl seiner Mieter gewisse persönliche Präferenzen haben – jedoch niemals eine rassistische Diskriminierung! Ebenfalls zulässig sind Ausnahmen, wenn durch das Mietverhältnis ein besonderes Nähe- oder Vertrauensverhältnis begründet wird (§ 19 Abs. 5 S.1 AGG). Klassisches Beispiel: die Vermieterin wohnt im selben Haus oder auf demselben Grundstück wie der Mieter (§ 19 Abs. 5 S.2 AGG). In solchen Fällen darf sie bei der Mieterauswahl Aspekte berücksichtigen, die in normalen Vermietungen tabu wären – etwa kann sie entscheiden, wen sie in ihr eigenes Haus lässt, um ein harmonisches Zusammenleben zu gewährleisten. Wichtig: Diese Ausnahmen sind eng auszulegen und rechtfertigen keine pauschale Benachteiligung wegen Herkunft oder Hautfarbe. Eine Ablehnung allein aufgrund eines ausländisch klingenden Namens ist im Allgemeinen rechtswidrig. Die genannten Sonderregelungen dienen eher dazu, z.B. gemischte Bewohnerstrukturen oder besondere Wohnkonzepte zu ermöglichen, nicht dazu, persönliche Vorurteile zu legitimieren.
Nachweis einer Diskriminierung: Indizien und Testing
In der Praxis ist es oft schwierig, eine Diskriminierung schwarz auf weiß zu beweisen. Offene Diskriminierungen – etwa ein Inserat mit dem Wortlaut „Wohnung nur an Deutsche“ – sind zum Glück selten, aber wenn sie vorkommen, liegt der Verstoß klar auf der Hand. So wurde ein Vermieter in Augsburg, der genau dies in seiner Anzeige stehen hatte, zu 1.000 € Entschädigung verurteilt und gerichtlich dazu gebracht, diese Praxis künftig zu unterlassen. In den meisten Fällen äußert sich Diskriminierung jedoch verdeckter: Etwa indem Bewerber mit ausländischem Namen gar keine Reaktion oder nur eine formale Absage („leider bereits vergeben“) erhalten, während andere eingeladen werden. Wie kann man so etwas nachweisen?
Hier kommt die Beweiserleichterung des AGG ins Spiel. Nach § 22 AGG genügt es, wenn die benachteiligte Person Indizien darlegt, die eine Benachteiligung vermuten lassen. Es muss also kein lückenloser Vollbeweis gelingen; schon Tatsachen, die auf eine Diskriminierung hindeuten, reichen aus. Gelingt ein solcher Indizienbeweis, tritt eine Beweislastumkehr ein – dann muss der Vermieter oder Makler widerlegen, dass kein Verstoß vorlag, oder beweisen, dass seine Absage auf zulässigen Gründen beruhte.
Situation-Testing (auch Tester-Verfahren genannt) hat sich als wirkungsvolles Mittel erwiesen, um solche Indizien zu erlangen. Die Idee: Man fertigt eine oder mehrere vergleichbare Bewerbungen an, die sich nur in dem zu testenden Merkmal unterscheiden (z.B. Name, Herkunft, Alter oder Geschlecht). Im vorliegenden Fall wurde genau dies gemacht, indem identische Anfragen mit unterschiedlichen Namen versendet wurden. Fällt die Reaktion des Anbieters deutlich unterschiedlich aus – hier: Absage bei „Muhammad A.“ und Zusage bei „Max M.“ –, so ist der Verdacht der Diskriminierung erhärtet. Gerichte erkennen die Ergebnisse solcher Testings als beachtliche Indizien an. So haben etwa das Amtsgericht Charlottenburg (Urteil vom 14.01.2020 – 203 C 31/19) und das Amtsgericht Hamburg-Barmbek (Urteil vom 03.02.2017 – 811b C 273/15) in vergleichbaren Konstellationen die aus dem Testing gewonnenen Befunde als ausreichend angesehen, um eine Benachteiligung auf dem Wohnungsmarkt festzustellen.
Im aktuellen BGH-Fall war die Indizienlage ebenfalls sehr eindrucksvoll: Jede Anfrage mit ausländischem Namen wurde abgelehnt, jede mit deutsch klingendem Namen angenommen. Damit hatte die Klägerin ihr Soll erfüllt – mehr an Beweislast legt § 22 AGG ihr nicht auf. Nun lag es am Makler, einen plausiblen Alternativgrund darzulegen oder die Vermutung zu entkräften. Dies ist ihm nicht gelungen, sodass das Landgericht hier konsequent von einer Diskriminierung ausgegangen ist.
Rechtsfolgen: Ansprüche bei Verstoß gegen das AGG
Steht eine Diskriminierung im Sinne des AGG fest, stellt sich die Frage: Was kann der*die Benachteiligte verlangen? Lohnt sich der ganze Aufwand einer Klage überhaupt? Die Antwort lautet Ja, denn das AGG sieht wirksame Rechtsfolgen vor.
Zunächst kann im Idealfall tatsächlich die Wohnung selbst verlangt werden – d.h. Abschluss des Mietvertrags zu den ursprünglich angebotenen Konditionen (§ 21 Abs. 2 S.1 AGG). Dieses Recht auf Eingehung des Vertrags greift jedoch nur, solange die Wohnung noch frei ist. In der Realität ist das selten durchsetzbar, denn Vermieter vergeben Wohnungen meist zügig anderweitig. Sobald ein Dritter rechtswirksam den Mietvertrag erhalten hat, kann man diesem nicht die Wohnung wegnehmen. Daher kommt in den meisten Fällen stattdessen ein Schadensersatz in Geld in Betracht.
Das AGG unterscheidet hier zwischen materiellem Schaden und Entschädigung für immaterielle Nachteile (also eine Art Schadensersatz für die erlittene Persönlichkeitsverletzung, vergleichbar „Schmerzensgeld“ bei Diskriminierung). Nach § 21 Abs. 2 Satz 3 AGG muss die Entschädigung mindestens drei Monatsmieten (Nettokaltmieten) betragen, sofern jemand wegen Diskriminierung die Wohnung nicht anmieten konnte. Diese gesetzliche Untergrenze soll sicherstellen, dass Diskriminierungen nicht „eingepreist“ und mit einem symbolischen Betrag abgegolten werden. Je nach schwere des Falls kann der Anspruch auch deutlich höher liegen. In einem spektakulären Berliner Fall (AG Tempelhof-Kreuzberg) wurden etwa Mietern, die systematisch benachteiligt wurden, je 15.000 € Entschädigung zugesprochen. Üblich sind in weniger gravierenden Einzelfällen jedoch geringere Summen: So wurden in früheren Gerichtsentscheidungen z.B. 3.000 € Entschädigung für eine verweigerte Wohnungsbesichtigung wegen ausländischen Namens sowie etwa 1.000 € in einem anderen Diskriminierungsfall zugesprochen. Die vom Landgericht Darmstadt festgesetzten 3.000 € liegen in dieser Größenordnung und orientieren sich offensichtlich an der Dreifach-Monatsmiete (was darauf hindeutet, dass die betroffene Wohnung etwa 1.000 € Kaltmiete gekostet hätte). Die Entschädigung dient dabei vor allem der Genugtuung für die Persönlichkeitsrechtsverletzung und soll auch präventiv wirken – sie ist kein „Schadensersatz“ im Sinne entgangenen Gewinns, sondern eine Wiedergutmachung für die erlittene Herabwürdigung.
Neben der Entschädigung können auch materielle Schäden ersetzt verlangt werden, sofern solche entstanden sind. Im vorliegenden Fall machte die Klägerin z.B. vorgerichtliche Anwaltskosten geltend – diese werden üblicherweise erstattet, wenn die Klage erfolgreich ist (da der Rechtsverstoß des Beklagten die Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe notwendig machte). Hätte die Mietinteressentin etwa durch die Diskriminierung weitere finanzielle Nachteile erlitten (z.B. weil sie längere Zeit eine teurere Ersatzwohnung beziehen musste), könnten auch solche Mehrkosten als Schadensersatz geltend gemacht werden.
Nicht zu unterschätzen ist ferner der Anspruch auf Unterlassung weiterer Benachteiligungen (§ 21 Abs. 2 AGG). Ein diskriminierender Vermieter kann also gerichtlich dazu verpflichtet werden, es zukünftig zu unterlassen, bestimmte diskriminierende Praktiken fortzuführen. Im Augsburger Fall etwa wurde dem Vermieter untersagt, nochmals Inserate mit der Formulierung „nur an Deutsche“ zu schalten, widrigenfalls ihm ein Ordnungsgeld droht. Ein solcher Unterlassungsanspruch ist besonders dann relevant, wenn ein systematisches Fehlverhalten vorliegt, das auch künftige Interessenten betreffen könnte.
Wichtig für Benachteiligte: Alle genannten Ansprüche müssen zeitnah geltend gemacht werden. Das AGG setzt eine kurze Frist von 2 Monaten ab dem benachteiligenden Ereignis (hier: der Absage) für die Geltendmachung gegenüber der Gegenseite. Innerhalb dieser Frist sollte der Anspruch schriftlich erhoben werden (z.B. durch ein Anwaltsschreiben, das Entschädigung fordert). Verstreicht die Zwei-Monats-Frist ungenutzt, kann der Anspruch verwirkt sein. Danach bleibt – wenn überhaupt – nur noch der „normale“ Zivilrechtsweg mit evt. Schadenersatzansprüchen aus Delikt, die aber wesentlich schwerer durchzusetzen sind. Daher gilt: bei Diskriminierungsverdacht sofort beraten lassen und Ansprüche fristwahrend anmelden!
Tipps für Mietinteressenten: So wehren Sie sich gegen Diskriminierung
Wer als Wohnungssuchende*r das Gefühl hat, aufgrund eines persönlichen Merkmals (etwa Herkunft, Name, Religion, Familienstand etc.) benachteiligt worden zu sein, sollte folgende Ratschläge beherzigen:
- Verdacht ernst nehmen und dokumentieren: Nehmen Sie diskriminierende Bemerkungen oder auffällige Absagen nicht einfach hin. Notieren Sie sich Zeitpunkt, Inhalt und beteiligte Personen bei verdächtigen Vorfällen. Bewahren Sie E-Mails, Briefe oder Chatverläufe auf, in denen Absagen erteilt oder anzügliche Fragen gestellt wurden. Jede Dokumentation kann später als Indiz helfen.
- Testing anwenden: Wenn Sie vermuten, wegen eines Merkmals abgelehnt worden zu sein (z.B. wegen Ihres ausländischen Namens), erwägen Sie ein Testverfahren. Bitten Sie zum Beispiel eine Vertrauensperson mit „neutralem“ oder anders klingendem Namen, sich ebenfalls auf die Wohnung zu bewerben – mit ansonsten gleichen Daten. Oder senden Sie selbst eine zweite Bewerbung unter Pseudonym. Fällt die Resonanz anders aus (Sie selbst werden abgelehnt, die fiktive Person aber eingeladen), haben Sie ein starkes Indiz in der Hand. Sammeln Sie möglichst mehrere solcher Vergleichsfälle.
- Beratung und Unterstützung suchen: Scheuen Sie sich nicht, Hilfe zu holen. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bietet Beratung an und kann Betroffene an lokale Beratungsstellen vermitteln. Dort kennt man sich mit dem AGG aus und kann bei der weiteren Vorgehensweise unterstützen. Auch Mietervereine oder spezialisierte Anwälte sind gute Anlaufstellen. Eine frühe Beratung stellt sicher, dass Sie keine Fristen versäumen und Ihre Rechte optimal wahren.
- Ansprüche fristgerecht geltend machen: Wie oben erwähnt, müssen Entschädigungsansprüche spätestens innerhalb von 2 Monaten nach der Diskriminierung gegenüber dem Vermieter/Makler erhoben werden. Am besten geschieht dies schriftlich und nachweisbar (per Einschreiben oder über den Anwalt). Formulieren Sie klar, was vorgefallen ist, worin Sie die Benachteiligung sehen, und fordern Sie eine Entschädigung nach § 21 AGG (ggf. mit konkreter Summe). Lassen Sie sich hierbei am besten anwaltlich beraten.
- Gerichtlich vorgehen (wenn nötig): Reagiert die Gegenseite nicht oder bestreitet sie alles, schrecken Sie nicht davor zurück, Ihr Recht vor Gericht einzufordern. Auch wenn der Ausgang nie garantiert werden kann – es gibt inzwischen genügend Beispiele erfolgreicher Klagen von diskriminierten Mietern. Die Gerichte haben in den letzten Jahren mehrfach zugunsten Benachteiligter entschieden und Entschädigungen zugesprochen. Ihre Klage hat also durchaus Aussicht auf Erfolg, vor allem wenn die Indizienlage durch Tests etc. gut vorbereitet wurde. Und selbst eine gütliche Einigung oder Mediation kann durch das Anstreben eines Gerichtsverfahrens erreicht werden.
Tipps für Vermieter und Makler: Diskriminierungsfrei vermieten
Für Vermieter und Immobilienmakler gilt es, die Vorgaben des AGG unbedingt ernst zu nehmen – nicht nur aus Furcht vor Rechtsfolgen, sondern auch aus Verantwortung für ein faires Miteinander. Hier einige Empfehlungen, um gar nicht erst in die Diskriminierungsfalle zu tappen:
- Klare Kriterien statt Vorurteile: Legen Sie objektive, sachliche Kriterien für die Mieterauswahl fest (z.B. Einkommensnachweis, Schufa-Auskunft, Haushaltsgröße passend zur Wohnung etc.). Unzulässige Merkmale wie Ethnie, Hautfarbe, Name, Religion oder Familienstand dürfen keine Rolle spielen. Machen Sie sich bewusst, dass subjektive Vorbehalte („der Name klingt ausländisch“, „passt nicht ins Haus“) nicht nur ungerecht, sondern rechtswidrig.
- Keine diskriminierenden Formulierungen: Vermeiden Sie in Wohnungsannoncen oder Gesprächen jede Formulierung, die auf eine Bevorzugung oder Ablehnung bestimmter Gruppen hindeuten könnte. Sätze wie „nur an Deutsche“ oder „keine Ausländer“ sind absolut tabu – sie verstoßen direkt gegen das AGG und können sofort Entschädigungsansprüche auslösen. Aber auch indirekte Umschreibungen („passt nicht ins Haus“, „für unser Mietumfeld ungeeignet“) können im Streitfall als Indiz für Diskriminierung gewertet werden. Kommunizieren Sie daher wertneutral und fokusieren Sie auf die sachlichen Voraussetzungen (z.B. „max. 4 Personen“, „regelmäßiges Einkommen erforderlich“, etc.).
- Makler sorgfältig instruieren: Wenn Sie als Vermieter einen Makler einschalten, machen Sie ihm gegenüber unmissverständlich klar, dass Diskriminierungsfreiheit oberstes Gebot ist. Etwaige Wunschprofile dürfen keine AGG-widrigen Kriterien enthalten. Bedenken Sie: Gibt der Vermieter dem Makler freie Hand, haftet der Makler zwar selbst für Diskriminierungen – der Imageschaden trifft aber auch den Eigentümer. Zudem könnten findige Kläger im Zweifel auch beide in Anspruch nehmen. Daher: wählen Sie seriöse Makler und besprechen Sie die Spielregeln.
- Im Zweifel: Ausnahmefälle prüfen: Wenn Sie der Meinung sind, ein bestimmtes Auswahlverhalten sei durch eine der AGG-Ausnahmen gedeckt (z.B. weil es sich um eine Einliegerwohnung in Ihrem eigenen Haus handelt oder Sie ein sozial integratives Wohnprojekt steuern), lassen Sie sich rechtlich beraten, ob diese Ausnahme tatsächlich greift. Die Gerichte legen die Ausnahmen eng aus. Zum Beispiel rechtfertigt der Wunsch nach einer „sozial stabilen Bewohnerstruktur“ (§ 19 Abs. 3 AGG) keineswegs pauschal die Ablehnung von Bewerbern wegen ihrer Herkunft – solche Konzepte müssen gut begründet und diskriminierungsfrei ausgestaltet sein. Im Zweifel sollten Sie lieber auf Nummer sicher gehen und alle Bewerber gleichbehandeln.
- Dokumentation und Transparenz: Ein Tipp aus Compliance-Sicht: Dokumentieren Sie den Auswahlprozess für eine Wohnungsvermietung. Notieren Sie, welche Kriterien zur Entscheidung geführt haben (z.B. „Bewerber A hatte unbefristeten Arbeitsvertrag, Bewerber B nur Probezeit“). Solche Aufzeichnungen können im Ernstfall helfen zu belegen, dass die Entscheidung nicht willkürlich oder diskriminierend war, sondern auf legitimen Gründen basierte. Achten Sie jedoch auf Datenschutz (Bewerberdaten vertraulich behandeln und nach Abschluss des Vorgangs löschen).
- Schulung und Sensibilisierung: Gerade Immobilienmakler, die tagtäglich viele Anfragen bearbeiten, sollten in Sachen AGG geschult sein. Sensibilisieren Sie Ihr Personal dafür, dass z.B. das „Aussortieren“ ausländisch klingender Namen rechtswidrig ist. Dies mag selbstverständlich klingen, aber wie der vorliegende Fall zeigt, kommt diskriminierendes Verhalten leider vor – teils bewusst, teils unbewusst. Interne Richtlinien oder Trainings zum fairen Vermieten können hilfreich sein.
Abschließend sei betont: Ein diskriminierungsfreier Wohnungsmarkt liegt im Interesse aller. Vermieter und Makler erweitern durch faire Auswahl ihren Kreis potentieller guter Mieter und vermeiden Rechtsstreitigkeiten. Mietinteressenten wiederum haben das Recht, allein nach ihrer Zahlungsfähigkeit und Zuverlässigkeit beurteilt zu werden, nicht nach Vorurteilen. Der aktuelle Fall vor dem BGH wird voraussichtlich ein wichtiges Zeichen setzen, dass ethnische Diskriminierung bei der Wohnungssuche keinen Platz haben darf. Bereits jetzt zeigt die Rechtsprechung klar: Solches Verhalten ist „schlichtweg nicht hinnehmbar“. Betroffene sollten ihre Rechte kennen und einfordern – und Vermieter/Makler gut beraten sein, sich an die gesetzlichen Gleichbehandlungsgebote zu halten. Denn Vielfalt und Fairness sind letztlich für ein gedeihliches Mietverhältnis ebenso grundlegend wie Vertragstreue und pünktliche Mietzahlungen.
Der Fall erinnert alle Beteiligten daran, dass das AGG kein zahnloser Tiger ist. Diskriminierung im Mietrecht kann Konsequenzen haben – rechtlich, finanziell und reputationsmäßig. Das Gebot der Fairness und Gleichbehandlung sollte daher Leitlinie jeder Wohnungsvermittlung sein, im Interesse einer gerechten Wohnungsmarkt-Kultur. Mieterinnen, die Diskriminierung erfahren, stehen wirksame Mittel zur Wehr zur Verfügung – scheuen Sie sich nicht, diese zu nutzen. Vermieter und Makler hingegen sollten proaktiv für diskriminierungsfreie Abläufe sorgen. Der BGH wird hierzu bald ein letztinstanzliches Wort sprechen. Sobald die Entscheidung vorliegt, werden wir Sie an dieser Stelle über die weiteren Klarstellungen informieren. Bis dahin gilt: Bleiben Sie wachsam und treten Sie für Ihre Rechte bzw. Pflichten ein – fair mieten, fair wohnen!