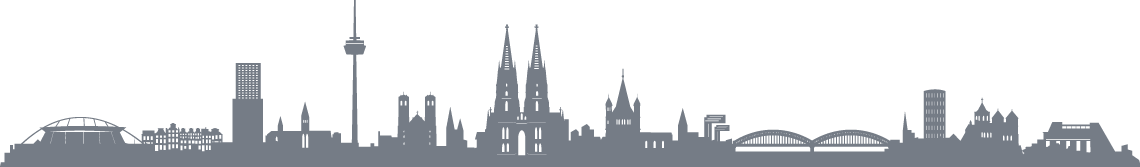Eigenbedarfskündigungen gehören zu den häufigsten Streitpunkten im Mietrecht. Vermieter können ein Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs kündigen, wenn sie die Wohnung für sich oder nahe Angehörige benötigen (vgl. § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB). Allerdings stellt das Gesetz strenge Anforderungen an die Begründung einer solchen Kündigung. Eine aktuelle Entscheidung des Landgerichts Heilbronn (Urteil vom 30.10.2025 – Az. 3 S 12/25) verdeutlicht, dass pauschale Floskeln wie Alter, Trennung oder „geänderte Lebenssituation“ im Kündigungsschreiben nicht ausreichen. Sowohl Vermieter als auch Mieter sollten die Anforderungen an eine wirksame Eigenbedarfskündigung genau kennen, um ihre Rechte zu wahren.
Rechtlicher Rahmen: Begründungspflicht bei Eigenbedarf
Das Bürgerliche Gesetzbuch schreibt vor, dass der Vermieter einer ordentlichen Kündigung die Gründe für sein berechtigtes Interesse im Kündigungsschreiben angeben muss (vgl. § 573 Abs. 3 Satz 1 BGB). Diese Begründungspflicht ist keine bloße Formalie, sondern soll den Mieter frühzeitig in die Lage versetzen, seine Rechtsposition zu erkennen und seine Interessen zu wahren. Die Wirksamkeit der Kündigung hängt davon ab – fehlt eine ausreichende Begründung, ist die Kündigung formal unwirksam.
In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) ist anerkannt, dass das Kündigungsschreiben den Kündigungsgrund so benennen muss, dass er für den Mieter identifizierbar ist und nicht mit allgemeinen Leerformeln verwechselt werden kann. Bei einer Eigenbedarfskündigung bedeutet das konkret: Die Person, für die die Wohnung benötigt wird, muss benannt werden (z. B. der Vermieter selbst, dessen Kind oder ein anderer naher Angehöriger). Ebenso muss das Interesse dieser Person an der Wohnung dargelegt werden – also der Grund, warum gerade diese Wohnung gebraucht wird. Es genügt, wenn der Kündigungsgrund in diesem Sinne erkennbar und von anderen Gründen unterscheidbar ist. Eine detaillierte Schilderung aller Einzelheiten ist im Kündigungsschreiben nicht erforderlich, wohl aber eine konkrete Beschreibung des Eigenbedarfs. Ob der behauptete Eigenbedarf tatsächlich besteht, ist erst im Streitfall vor Gericht zu beweisen – aber die Kernfakten müssen bereits im Schreiben stehen.
LG Heilbronn: Konkrete Umstände statt Floskeln
Das Landgericht Heilbronn hat in seinem Urteil vom 30.10.2025 eindrücklich aufgezeigt, dass allgemeine Schlagworte im Kündigungsschreiben nicht genügen. Im entschiedenen Fall hatte der Vermieter den Mietern im August 2023 wegen Eigenbedarfs gekündigt. Zur Begründung führte er lediglich an, dass er nach Auszug der Mieter selbst einziehen werde und die Kündigung aufgrund seiner Trennung von der Ehefrau, seiner derzeitigen Wohnsituation und seines Alters unumgänglich sei.
Das Amtsgericht hatte diese knappe Begründung zunächst als wirksam anerkannt und die Mieter zur Räumung verurteilt. In der Berufung jedoch gab das Landgericht den Mietern Recht: Das Kündigungsschreiben erfüllte nicht die gesetzlichen Anforderungen aus § 573 Abs. 3 BGB. Die genannten Stichworte – Trennung, Alter und vage beschriebene „jetzige Wohnsituation“ – blieben nach Ansicht des Gerichts floskelhaft und inhaltsleer. Warum die aktuelle Wohnsituation des Vermieters und sein Alter den Umzug „unumgänglich“ machten, wurde in keiner Weise nachvollziehbar erläutert. Es fehlte insbesondere die Darlegung, weshalb gerade die konkrete Mietwohnung benötigt wird und warum der Vermieter nicht in seiner bisherigen Wohnung bleiben konnte. Durch diese Lücken wirkte die Kündigung auf das Gericht wie eine unzulässige „Vorratskündigung“, also eine Kündigung auf Verdacht ohne akuten Bedarf. Die formellen Voraussetzungen einer wirksamen Eigenbedarfskündigung waren damit nicht erfüllt, und die Kündigung wurde als unwirksam angesehen.
Bemerkenswert an der Entscheidung ist, dass sie die Linie der höchstrichterlichen Rechtsprechung bestätigt und konkretisiert. Zwar darf die Hürde für Vermieter nicht so hoch gelegt werden, dass Kündigungen unzumutbar erschwert werden. Aber Vermieter müssen die Kerntatsachen des Eigenbedarfs klar benennen, damit der Mieter die Lage verstehen kann. Pauschale Floskeln oder Gefühlsbekundungen reichen nicht – Eigenbedarf ist „kein Gefühl, sondern ein belegbares Bedürfnis“, erinnert das LG Heilbronn treffend.
Anforderungen an eine substantielle Begründung
Welche konkreten Umstände müssen also dargelegt werden, um eine Eigenbedarfskündigung substantiiert zu begründen? Aus Gesetz und Rechtsprechung lassen sich folgende Punkte ableiten, die in jedem Kündigungsschreiben wegen Eigenbedarfs deutlich gemacht werden sollten:
- Bedarfsperson und Beziehung zum Vermieter: Es muss klar sein, wer die Wohnung beziehen soll. Ist es der Vermieter selbst, dessen Tochter, ein Sohn, Elternteil oder eine andere berechtigte Person? Nennung von Name oder zumindest Beziehung (z. B. „mein Sohn“) ist erforderlich. Unklare Formulierungen ohne konkrete Person (“für familiäre Zwecke” o. ä.) genügen nicht.
- Konkreter Anlass und Nutzen: Es muss erklärt werden, warum diese Person die Wohnung benötigt. Welche Veränderung ist eingetreten? Beispiele: Trennung: Wer hat sich getrennt, und wer braucht nun Wohnraum, weil er etwa aus der bisherigen gemeinsamen Wohnung ausziehen muss? Familienzuwachs: Wer erwartet ein Kind und warum wird dadurch mehr Platz benötigt? Alter/Gesundheit: Welche Einschränkungen bestehen (z. B. Treppensteigen), sodass die bisherige Wohnung ungeeignet ist und die Erdgeschosswohnung des Mieters benötigt wird? Allgemeine Aussagen wie „aus Altersgründen“ oder „wegen geänderter Lebensumstände“ sollten durch konkrete Erläuterungen untermauert werden.
- Warum gerade diese Wohnung?: Der Vermieter sollte darlegen, weshalb die konkret vermietete Wohnung für den Eigenbedarf ausgewählt wurde. Gibt es besondere Eigenschaften (Lage, Größe, Zuschnitt), die sie für die Bedarfsperson passend machen? Hat der Vermieter möglicherweise keine andere geeignete Immobilie zur Verfügung? Diese Erläuterung macht den Eigenbedarf nachvollziehbar. Fehlt ein solcher Bezug, entsteht leicht der Eindruck, die Kündigung erfolge „auf Vorrat“ ohne konkreten Plan.
- Aktualität und Ernsthaftigkeit des Bedarfs: Der Bedarf muss zum Zeitpunkt der Kündigung bereits bestehen oder absehbar unmittelbar bevorstehen. Bloße Zukunftspläne oder Eventualitäten genügen nicht. Formulierungen sollten zeigen, dass der Vermieter fest entschlossen ist, die Wohnung selbst (oder durch die Bedarfsperson) zu nutzen, sobald sie frei wird. Ein konkreter Zeitplan (etwa „ab Januar nächsten Jahres“) kann die Ernsthaftigkeit untermauern. Wichtig: Der Kündigungsgrund darf nicht nachträglich vorgeschoben werden; er muss schon im Kündigungszeitpunkt vorliegen.
- Keine überflüssigen Details: Zwar muss die Begründung konkret und plausibel sein, jedoch nicht überfrachtet werden. Es reicht, den Kern des Bedarfs zu schildern (Person + Grund + Wohnung). Zu viele Details können das Schreiben unübersichtlich machen. Im Streitfall wird das Gericht die Hintergründe ohnehin genauer prüfen – im Kündigungsschreiben geht es primär darum, den Grund erkennbar und verständlich mitzuteilen.
Wenn all diese Punkte beachtet werden, enthält das Kündigungsschreiben einen roten Faden, der den Eigenbedarf nachvollziehbar erscheinen lässt. Vermieter tun gut daran, hier Sorgfalt walten zu lassen. Im Zweifel sollte professionelle Hilfe (Rechtsberatung) in Anspruch genommen werden, um sicherzustellen, dass die Kündigung den formellen Anforderungen entspricht. Standardvorlagen oder Textbausteine, die lediglich Schlagworte aufführen, sind gefährlich – sie werden von Gerichten als „formelhaft“ und unzureichend bewertet.
Was bedeutet das für Vermieter und Mieter?
Für Vermieter zeigt diese Entscheidung klar: Eine Eigenbedarfskündigung muss gründlich vorbereitet werden. Es genügt nicht, berechtigte Gründe zu haben – man muss sie im Schreiben auch klar darlegen. Andernfalls riskiert man, dass die Kündigung schon aus formellen Gründen scheitert. Im Heilbronner Fall verlor der Vermieter wertvolle Zeit, weil seine erste Kündigung unwirksam war; eine Nachbesserung durch eine zweite Kündigung verzögerte das Verfahren weiter. Dieses Risiko lässt sich vermeiden, wenn von Anfang an eine substanzielle Begründung geliefert wird. Vermieter sollten sich fragen: „Würde ein unbeteiligter Dritter verstehen, warum ich genau diese Wohnung jetzt selbst brauche?“ – Ist diese Frage nicht klar beantwortet, muss die Begründung konkreter gefasst werden.
Auch Mieter sollten aufmerksam prüfen, wie ein Kündigungsschreiben begründet ist. Erhält ein Mieter eine Eigenbedarfskündigung, in der nur allgemeine Gründe stehen („persönliche Gründe“, „Veränderung der Lebensumstände“ o. ä.), ohne greifbare Erläuterung, lohnt es sich, die Wirksamkeit anzuzweifeln. Mieterrechte: Stellt sich heraus, dass die Begründung den Anforderungen des § 573 Abs. 3 BGB nicht genügt, kann die Kündigung angefochten werden – mit der Folge, dass der Mieter nicht ausziehen muss. Die Heilbronner Entscheidung betont, dass diese Begründungspflicht ein Schutzinstrument für Mieter ist. Mieter sollten sich daher im Zweifel rechtlich beraten lassen, ob eine Kündigung eventuell formell unwirksam ist. Allerdings gilt: Auch Mieter dürfen eine Eigenbedarfskündigung nicht auf die leichte Schulter nehmen – sofern die Gründe im Schreiben plausibel dargelegt sind, muss ein Widerspruch gut begründet sein (etwa mit einer Härtefallregelung nach § 574 BGB, beispielsweise hohes Alter oder schwere Krankheit des Mieters).
Die Kernbotschaft des Rechtstipps lautet: Ohne substanzielle Begründung keine wirksame Eigenbedarfskündigung. Vermieter müssen im Kündigungsschreiben klar und nachvollziehbar darlegen, wer die Wohnung aus welchem konkreten Anlass benötigt. Allgemeine Schlagworte – sei es hohes Alter, eine Trennung oder eine vage „geänderte Lebenssituation“ – genügen nicht. Vielmehr sind konkrete Umstände und ein echter Nutzungswille darzulegen. Nur so lässt sich der Schutzgedanke des § 573 Abs. 3 BGB erfüllen, der Mieter vor überraschenden oder vorgeschobenen Kündigungen bewahren soll.
Für Vermieter bedeutet dies: Sorgfältige Vorbereitung einer Eigenbedarfskündigung zahlt sich aus. Eine gut begründete Kündigung hat vor Gericht weit bessere Erfolgschancen und erspart langwierige Streitigkeiten. Für Mieter bedeutet es: Eine Kündigung genau lesen und bei Zweifel an der Begründung nachhaken. Die Entscheidung des LG Heilbronn vom 30.10.2025 unterstreicht, dass Eigenbedarfskündigungen kein Platz für Floskeln ist – entscheidend sind greifbare Fakten und ein echter Bedarf. Sowohl Vermieter als auch Mieter sind daher gut beraten, Eigenbedarfskündigungen ernst zu nehmen und ihre Rechte sowie Pflichten zu kennen. Mit fundierter Begründung und Kenntnis der Rechtslage lässt sich vieles klären, bevor der Streit vor Gericht landet.