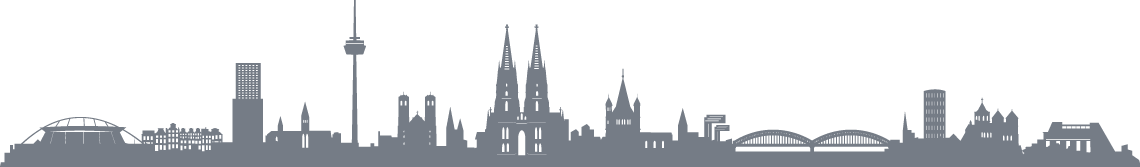Wer auf eisglatten Wegen stürzt, kann künftig leichter Schadensersatz und Schmerzensgeld verlangen. In einer neuen Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) haben die Karlsruher Richter klargestellt, dass die Hürden für den Nachweis “allgemeiner Glätte” – also flächendeckender Eisglätte, bei der gestreut werden muss – nicht übertrieben hoch sein dürfen. Das bedeutet: Unfallopfer haben bessere Chancen, den Verantwortlichen wegen verletzter Streupflicht zur Rechenschaft zu ziehen, wenn dieser seine Pflicht zum Winterdienst vernachlässigt hat. Im Folgenden erklären wir verständlich, was der BGH entschieden hat, wann eine Streupflicht besteht, und welche Folgen das Urteil für Geschädigte und Verkehrssicherungspflichtige (z.B. Grundstückseigentümer oder Winterdienste) hat. Dazu geben wir konkrete Tipps, wie Sie sich im Winter rechtssicher verhalten können.
Allgemeine Glätte: Wann muss im Winter gestreut werden?
Grundstückseigentümer, Mieter mit Kehrdienstpflicht und Gemeinden sind im Winter grundsätzlich verpflichtet, Gehwege und Zugänge zu räumen und zu streuen, um Unfälle durch Glatteis zu verhindern. Juristisch spricht man von der Räum- und Streupflicht als Teil der Verkehrssicherungspflicht. Diese Pflicht besteht jedoch nicht bei jeder Kleinigkeit: Grundvoraussetzung für eine Streupflicht ist, dass eine konkrete Gefahrenlage durch Glätte entsteht – es muss “allgemeine Glätte” vorliegen, nicht nur eine vereinzelte Eisstelle. Mit allgemeiner Glätte ist gemeint, dass flächendeckend Glatteis oder Schneeglätte vorhanden ist, zum Beispiel weil winterliche Witterung den gesamten Gehweg oder größere Bereiche glatt gemacht hat. Einzelne kleine Glättestellen (z.B. ein isolierter vereister Fleck durch eine lokale Pfütze) lösen in der Regel noch keine Streupflicht aus – denn niemand kann jeden Quadratmeter ständig eisfrei halten. Erst wenn weitläufig glatt ist oder ernsthaft mit Glätte zu rechnen ist, muss gestreut werden.
Allerdings gibt es Grauzonen: In Ausnahmefällen kann auch eine lokal begrenzte Glättestelle eine Streupflicht auslösen, wenn von ihr eine ernsthafte Gefahr ausgeht. Entscheidend sind immer die Umstände des Einzelfalls – etwa wie umfangreich die Glätte ist, wie stark begangen der Weg üblicherweise wird und ob die Gefahr vorhersehbar war. Im Zweifelsfall sollten Sicherungspflichtige eher früher und großzügig streuen, um Unfälle zu vermeiden.
BGH-Entscheidung: Streupflicht nicht zu streng auslegen
Der BGH hat in seinem Beschluss vom 1. Juli 2025 (Az. VI ZR 357/24) eine klarere Linie gezogen, wann von “allgemeiner Glätte” auszugehen ist und damit gestreut werden muss. Im zugrundeliegenden Fall stürzte eine 85-jährige Frau an einem Februar-Nachmittag auf einem vereisten Gehweg vor einem Wohnhaus. Dort hatte sich trotz Temperaturen um 0 °C eine dicke Eisschicht auf dem Gehweg gebildet. Die Seniorin verletzte sich beim Sturz, eine begleitende Person rutschte ebenfalls aus (blieb aber unverletzt). Die Frau behauptete, der Hausbesitzer habe seit Tagen nicht gestreut, während vor den Nachbarhäusern gestreut gewesen sei. Der Hauseigentümer entgegnete, er habe am Morgen gestreut.
In den Vorinstanzen hatte die Frau keinen Erfolg – weder vor dem Landgericht Gießen noch vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Die Gerichte meinten, ihr Vortrag sei nicht substantiiert genug: Sie habe nicht schlüssig dargelegt, dass allgemeine Glätte herrschte. Insbesondere habe sie zunächst nichts zur generellen Wetterlage gesagt, sondern nur die Temperatur (0 °C) erwähnt. Ein Nullpunkt an einem einzelnen Tag genüge nicht, um automatisch eine Streupflicht anzunehmen, so das OLG. Außerdem warfen die Richter der Frau vor, ein erhebliches Mitverschulden zu tragen: Sie habe die Glätte mit “sehenden Augen” in Kauf genommen, weil erkennbar gewesen sei, dass der Weg nicht gestreut war. Immerhin hätte sie auf die andere (gestreute) Straßenseite ausweichen können, statt über die vereiste Stelle zu gehen, argumentierte das OLG.
Der BGH sah diese Beurteilung deutlich kritischer – und hob das Urteil der Vorinstanz auf. Die Karlsruher Richter betonten zunächst die allgemeinen Grundsätze: Eine Streupflicht setzt eine konkrete Glättegefahr voraus, also allgemeine Glättebildung und nicht bloß einzelne Eisflecken. Zugleich dürfe man aber die Anforderungen an den Vortrag des Geschädigten nicht überspannen. Mit anderen Worten: Ein Unfallopfer muss zwar grundsätzlich beweisen, dass zur Unfallzeit wegen der Wetter- und Wegeverhältnisse gestreut werden musste und dass der Verantwortliche dem pflichtwidrig nicht nachgekommen ist. Aber das Gericht darf an diese Behauptungen keine überzogenen Maßstäbe anlegen. Es reicht, wenn der Geschädigte plausibel schildert, dass es glatt war – z.B. dass sich bei Frost eine Eisdecke auf dem Gehweg gebildet hatte. Genau das hatte die Seniorin getan: Sie hatte schon vor Gericht erster Instanz angegeben, dass am Unfalltag Glatteis bei etwa 0 °C vorhanden war, und sogar angeboten, ein Wettergutachten einzuholen, um dies zu belegen. Damit habe sie implizit auch behauptet, dass es sich um allgemeine Glätte handelte (sie verwies ja selbst auf das Argument des Gegners, dass eine Streupflicht nur bei allgemeiner Glätte bestehe). Zudem war gerichtsbekannt vorgetragen, dass der Gehweg des Beklagten durchgehend spiegelglatt vereist war, während die benachbarten Wege gestreut waren. Für den BGH war kein weiterer Detail-Vortrag nötig, “welche Parameter neben den Temperaturen um den Gefrierpunkt zu der behaupteten allgemeinen Glätte führten” – all das machte die Klage bereits schlüssig genug.
Mit dieser Entscheidung hat der BGH die Anforderungen an den Nachweis allgemeiner Glätte konkretisiert und faktisch etwas herabgesetzt. Künftig dürfte es genügen, wenn ein Kläger darlegt, dass es an der Unfallstelle aufgrund winterlicher Witterung flächig glatt war – etwa weil sich eine Eisschicht gebildet hatte – ohne dass er gleich Belege für eine überregionale Glättewelle oder extreme Wetterchaos liefern muss. Im vorliegenden Fall hätte das OLG also die Schilderungen der Frau (spiegelglatter Gehweg bei Frost) ausreichen lassen und die angebotenen Beweise erheben müssen, statt zusätzliche Wetterdaten oder “chaotische Zustände” im gesamten Umland zu fordern. Der BGH rügte explizit, dass die Vorinstanz das ergänzende Vorbringen der Frau zur hessenweiten Kältewelle à −°C und dem Verkehrschaos zu Unrecht als verspätet ignoriert hatte – dadurch wurde ihr Recht auf Gehör verletzt.
Fazit dieses Urteils: Die Eigentümerseite kann sich nicht mehr so leicht darauf berufen, ein Unfallopfer habe nicht genügend Wetter-Belege für die Streupflicht geliefert. Wenn es offensichtlich glatt war, spricht viel für eine allgemeine Glättebildung – und damit für eine Verletzung der Streupflicht, falls nicht gestreut wurde. Diese Klarstellung stärkt die Position Geschädigter erheblich.
Sichtbare Glätte: Opfer nicht automatisch selbst schuld
Ein weiterer wichtiger Punkt der BGH-Entscheidung betrifft das Mitverschulden (die Mitschuld) der Gestürzten. Das OLG hatte der Frau vorgeworfen, sie allein trage die Verantwortung, weil sie sich “sehenden Auges” auf den glatten Weg begeben habe, obwohl ein gestreuter Weg verfügbar war. Der BGH hat diese Sichtweise korrigiert. Grundsätzlich gilt: Ein starkes Eigenverschulden des Verletzten kann die Haftung des Sicherungspflichtigen ausschließen – aber nur unter ganz besonderen Umständen. Nämlich dann, wenn der Geschädigte außergewöhnlich sorglos gehandelt hat. Bloße Erkennbarkeit von Eisglätte genügt dafür nicht. Mit anderen Worten: Selbst wenn eine Person die glatte Stelle hätte sehen können, heißt das nicht automatisch, dass ihr Schadensersatzanspruch entfällt. Im BGH-Fall hatte die Frau die Glätte erst in dem Moment bemerkt, als sie bereits darauf ausrutschte – und wollte dann sofort umkehren. Ihr kann daher keine grob unverständliche Sorglosigkeit vorgeworfen werden. Der BGH stellte klar, dass in solchen Fällen kein überwiegendes Mitverschulden des Opfers anzunehmen ist und dass im Zweifel der Streupflichtige den Beweis für ein extremes Fehlverhalten des Gestürzten tragen müsste.
Für die Praxis bedeutet das: Winter-Unfallopfer müssen nicht befürchten, leer auszugehen, nur weil die Glätte möglicherweise erkennbar war. Sofern sie nicht besonders unvorsichtig gehandelt haben (z.B. Rennen auf offenkundig vereister Fläche), bleibt derjenige in der Haftung, der seiner Streupflicht nicht nachgekommen ist. Auch diese Klarstellung des BGH stärkt die Rechte der Geschädigten.
Was bedeutet das Urteil für Geschädigte?
Für Unfallopfer von Glätteunfällen ist das BGH-Urteil eine gute Nachricht. Ihre Chancen, erfolgreich Schadensersatz und Schmerzensgeld geltend zu machen, steigen. Gerichte müssen nun großzügiger anerkennen, dass eine allgemeine Glätte vorlag, wenn offenkundig ein größerer Bereich glatt war. Sie als Geschädigter müssen nicht mehr befürchten, Ihre Klage könnte allein daran scheitern, dass Sie nicht das gesamte Wettergeschehen der Region belegen können. Wichtig ist vor allem, dass Sie darlegen und beweisen können, dass an der Unfallstelle Glatteis herrschte und dass der Verantwortliche nicht oder unzureichend gestreut hatte. Hier einige Tipps, was Sie als Betroffener tun sollten, wenn Sie auf eisglattem Boden gestürzt sind:
- Unfall dokumentieren: Sichern Sie sofort Beweise. Fotografieren Sie die Unfallstelle und die Glätte (z.B. die Eisschicht auf dem Weg). Notieren Sie Datum, Uhrzeit, Wetter (Temperatur, ob Niederschlag etc.) und ob angrenzende Bereiche gestreut waren. Solche Informationen untermauern Ihre Schilderung der Glätteverhältnisse.
- Zeugen ansprechen: Falls andere Personen den Sturz beobachtet haben oder ebenfalls ausgerutscht sind, bitten Sie um deren Kontaktdaten. Im BGH-Fall gab es einen Begleiter als Zeugen, was sehr hilfreich war. Aussagen von Zeugen können bestätigen, dass der Weg nicht gestreut und spiegelglatt war.
- Verletzungen feststellen: Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, lassen Sie Ihre Verletzungen dokumentieren und heben Sie Belege (Rezepte, Arzneimittel, Physiotherapie-Verordnungen) auf. Diese sind wichtig, um Schadensersatz (z.B. Behandlungskosten, Verdienstausfall) und insbesondere Schmerzensgeld der Höhe nach zu begründen.
- Schaden melden: Informieren Sie den Verkehrssicherungspflichtigen – etwa den Hauseigentümer oder die Stadtverwaltung – möglichst zeitnah schriftlich über den Vorfall und Ihre Forderung. So setzen Sie ihn in Verzug. Viele Eigentümer haben eine Haftpflichtversicherung, die dann den Schaden reguliert. Geben Sie aber keine Schuldanerkenntnisse ab und lassen Sie sich nicht abwimmeln.
- Rechtsrat einholen: Scheuen Sie sich nicht, einen Rechtsanwalt einzuschalten, wenn der Verantwortliche nicht klar zahlt. Nach einem erfolgreichen Anspruch muss der Gegner in der Regel auch die Anwaltskosten erstatten. Ein Anwalt kann Sie dabei unterstützen, Ihre Ansprüche mit Verweis auf die aktuelle BGH-Rechtsprechung geltend zu machen.
Durch das neue BGH-Urteil können Geschädigte selbstbewusster auftreten. Wenn Sie infolge unzureichenden Winterdienstes gestürzt sind, stehen die Chancen gut, dass Ihnen ein Gericht Recht gibt – vorausgesetzt, Sie können die Glätteverhältnisse und die fehlenden Sicherungsmaßnahmen überzeugend darstellen. Lassen Sie sich also nicht vorschnell mit dem Hinweis abspeisen, es sei “nicht überall glatt gewesen”. Im Zweifel entscheidet nun eher zu Ihren Gunsten, dass bei Glätte zu streuen gewesen wäre.
Was bedeutet das Urteil für Räum- und Streupflichtige?
Für Verkehrssicherungspflichtige – das sind insbesondere Grundstückseigentümer, Vermieter, Hausverwaltungen oder Kommunen, die für die verkehrssichere Beschaffenheit von Wegen sorgen müssen – erhöht das BGH-Urteil den Handlungsdruck. Klar ist: Man kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass ein Gericht die Anforderungen für die Streupflicht eng auslegt. Nach der neuen BGH-Linie wird eher angenommen, dass gestreut werden musste, sobald die Wetterlage zu nennenswerter Glätte geführt hat. Als Sicherungspflichtiger sollten Sie also im Winter besonders sorgfältig sein, um nicht haftbar gemacht zu werden. Beachten Sie die folgenden Hinweise, um Ihre Räum- und Streupflicht rechtssicher zu erfüllen:
- Wetterprognosen verfolgen: Informieren Sie sich regelmäßig über die Wettervorhersage. Bei angekündigtem Frost, Schneefall oder überfrierender Nässe sollten Sie vorbeugend Legen Sie rechtzeitig Streumaterial (Splitt, Sand, Salz – je nach örtlicher Satzung) bereit.
- Ortsrechtliche Pflichten einhalten: Fast jede Gemeinde hat Satzungen oder Verordnungen, die regeln, wann und wie zu streuen ist (z.B. werktags ab 7 Uhr, sonn- und feiertags ab 9 Uhr, bis abends 20 Uhr). Halten Sie diese Zeiten unbedingt ein und kontrollieren Sie bei länger andauerndem Schneefall oder Glatteis mehrmals am Tag, ob nachgestreut werden muss.
- Nicht nur den kleinen Fleck sehen: Verlassen Sie sich nicht darauf, dass es “nur stellenweise” glatt sei. Sobald eine allgemeine Glättegefahr besteht – etwa weil die Temperaturen um 0 °C liegen und Feuchtigkeit vorhanden ist – sollten Sie lieber einmal zu viel streuen als zu wenig. Die Gerichte werden eher zugunsten Gestürzter urteilen, wenn es irgendwo auf Ihrem Verantwortungsbereich glatt war. Im Zweifel wird man annehmen, dass eine Streupflicht bestand.
- Dokumentation führen: Es kann sinnvoll sein, ein Streuprotokoll zu führen. Notieren Sie Datum, Uhrzeit und was Sie unternommen haben (z.B. “07:00 Uhr Gehweg gefegt und Splitt gestreut”). Diese Notizen können im Ernstfall beweisen, dass Sie Ihrer Pflicht nachkamen. Auch Fotos vom gestreuten Weg können hilfreich sein.
- Haftpflichtversicherung prüfen: Stellen Sie sicher, dass Sie als Eigentümer oder Winterdienst eine Haftpflichtversicherung haben, die Glätteunfälle abdeckt (z.B. Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht). Sollte trotz aller Sorgfalt ein Unfall passieren, schützt Sie diese finanziell. Melden Sie einen Vorfall umgehend der Versicherung und kooperieren Sie bei der Aufklärung.
Letztlich dient gewissenhaftes Räumen und Streuen nicht nur der Rechtsabsicherung, sondern auch der Vermeidung von Verletzungen. Niemand möchte, dass vor der eigenen Haustür jemand zu Schaden kommt. Die Entscheidung des BGH sollte als Warnsignal verstanden werden: Wer seine Winterpflichten vernachlässigt, kann nun noch schneller in die Haftungsfalle geraten. Gerade wenn allgemeine Glätte herrscht, gibt es keine Ausrede mehr – dann muss gestreut werden, ansonsten haftet der Pflichtige für Sturzschäden.
Das BGH-Urteil vom 01.07.2025 erleichtert Geschädigten den Weg zu Schadensersatz, indem es die Voraussetzungen einer allgemeinen Glättebildung praxisnah definiert und die Anforderungen an den Opfervortrag senkt. Gleichzeitig mahnt es Verkehrssicherungspflichtige zu größerer Sorgfalt: Bei winterlicher Glätte lieber einmal mehr streuen als einmal zu wenig. Für Fußgänger heißt das: Stürzen Sie auf einem spiegelglatten, ungestreuten Weg, stehen Ihre Chancen auf Entschädigung gut. Für Verantwortliche heißt es: Nehmen Sie Ihre Streupflicht ernst, um Unfälle und Haftungsansprüche zu vermeiden. So kommen wir alle sicherer durch den Winter.