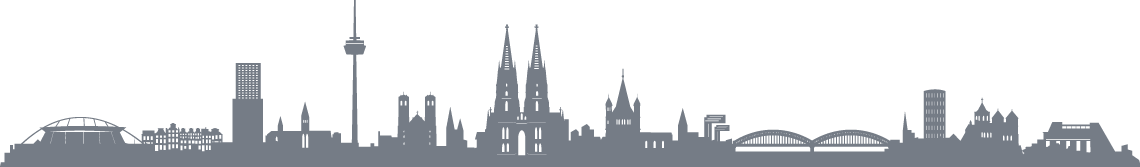Ausgangslage: Mieterhöhung und ortsübliche Vergleichsmiete
Vermieter von Wohnraum dürfen die Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete erhöhen, wenn bestimmte Fristen eingehalten sind und die formellen Voraussetzungen erfüllt werden (vgl. § 558 BGB). In der Praxis muss der Vermieter dem Mieter ein Mieterhöhungsverlangen in Textform erklären und sachlich begründen (vgl. § 558a Abs. 1–2 BGB). Für diese Begründung kann er beispielsweise auf den Mietspiegel, auf Vergleichsmieten ähnlicher Wohnungen oder auf ein Sachverständigengutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Gutachters verweisen. Besonders wenn kein Mietspiegel verfügbar ist oder die Wohnung Besonderheiten aufweist, ziehen Vermieter oft ein Gutachten in Betracht, um den ortsüblichen Mietwert zu untermauern.
Stellt der Mieter das Erhöhungsverlangen in Frage und verweigert die Zustimmung, kann der Vermieter innerhalb von drei weiteren Monaten Klage auf Zustimmung erheben (§ 558b Abs. 2 BGB). Im gerichtlichen Verfahren müsste dann die ortsübliche Vergleichsmiete bewiesen werden, wozu häufig ein vom Gericht beauftragter Sachverständiger die Wohnung bewertet. Streitpunkt war bislang, ob der Vermieter schon vor einer solchen Klage – quasi vorbereitend – ein gerichtliches Gutachten einholen darf, ohne dass bereits ein Rechtsstreit anhängig ist. Dieses würde im Wege eines selbständigen Beweisverfahrens nach § 485 ZPO geschehen, einem eigenständigen gerichtlichen Verfahren zur vorweggenommenen Beweisaufnahme. Das selbständige Beweisverfahren soll eigentlich dazu dienen, Beweise zu sichern oder Streitigkeiten zu vermeiden, bevor es zu einer Hauptsacheklage kommt. Darf also ein Vermieter vorsorglich das Gericht anrufen, um die ortsübliche Vergleichsmiete durch einen Sachverständigen feststellen zu lassen, bevor er überhaupt wirksam die Miete erhöht? Genau diese Frage war lange umstritten und wurde nun durch den Bundesgerichtshof (BGH) entschieden.
Streitige Rechtslage vor der BGH-Entscheidung
Bis zum aktuellen BGH-Beschluss gab es keine höchstrichterliche Entscheidung zu dieser Frage. In der Rechtsprechung und Literatur wurde sie seit Jahren kontrovers diskutiert. Einige Gerichte und Autoren befürworteten ein solches Vorgehen des Vermieters. Sie argumentierten im Wesentlichen, dass der Begriff „Zustand oder Wert einer Sache“ in § 485 Abs. 2 ZPO weit zu verstehen sei. Darunter falle auch der Ertragswert einer Mietsache, also der Mietwert der Wohnung, sodass die ortsübliche Vergleichsmiete als Wert der Wohnung durch ein Sachverständigengutachten ermittelt werden könne. Zudem könne ein frühzeitiges Gutachten dazu beitragen, einen Rechtsstreit zu vermeiden, weil der Mieter bei Vorlage eines neutralen gerichtlichen Gutachtens eher zur Zustimmung bereit sein könnte. Auch anerkannte ZPO-Kommentare wie etwa Zöller/Herget oder Fachliteratur aus den 1990er-Jahren (z.B. Scholl, NZM 1999, 396) vertraten diese Linie. Als Praxisbeispiel ist eine Entscheidung des LG Köln von 1995 bekannt, die ein solches selbständiges Beweisverfahren zur Mietwertermittlung für zulässig hielt.
Demgegenüber lehnte die wohl überwiegende Auffassung in Rechtsprechung und Literatur ein selbständiges Beweisverfahren zur Feststellung der ortsüblichen Miete ab. Bereits Ende der 1990er-Jahre entschieden zum Beispiel das LG Berlin und das LG Braunschweig, dass ein solcher Antrag unzulässig sei. In jüngerer Zeit haben Gerichte wie das LG Köln (mit einem anderen Spruchkörper im Jahr 1996) und das AG Hamburg 2024 diese Sichtweise bestätigt. Als Begründung wurde mehrfach angeführt, die ortsübliche Vergleichsmiete sei kein “Wert der Sache” im Sinne von § 485 Abs. 2 ZPO. Vielmehr handele es sich bei der Miethöhe um eine Rechtsfrage, die nur im Rahmen des Mieterhöhungsverfahrens und eines etwaigen Klageverfahrens zu klären sei. Außerdem fehle vor Ausspruch eines Mieterhöhungsverlangens ein konkreter Streitgegenstand und Stichtag – es stehe ja noch nicht fest, ab wann und in welcher Höhe die Miete erhöht werden soll. Einige Stimmen hoben auch hervor, dass vor Zugang eines formellen Erhöhungsverlangens noch kein Anspruch des Vermieters bestehe, den man gerichtlich prüfen könnte. Weiterhin wurde betont, der Vermieter dürfe seine gesetzliche Pflicht zur Begründung der Mieterhöhung nicht auf das Gericht abwälzen. Insbesondere solle er, wenn er ein Gutachten als Begründungsmittel wählt, dieses auf eigene Kosten einholen und nicht versuchen, die Kosten einem gerichtlichen Verfahren (und letztlich dem Mieter) aufzubürden. Schließlich – so ein weiteres Argument – enthalte das Mietrecht in §§ 558a ff. BGB bereits abschließende Sonderregeln, welche der allgemeinen Vorschrift des § 485 ZPO vorgehen sollten. Diese Spezialvorschriften regeln detailliert das Verfahren der Mieterhöhung, einschließlich Fristen und Pflichten, sodass daneben kein Raum für ein vorgelagertes Beweisverfahren sei.
Angesichts dieser Uneinigkeit warteten Praktiker und Vermieter seit langem auf eine klare Linie vom Bundesgerichtshof. Der VIII. Zivilsenat des BGH, der für Wohnraummietrecht zuständig ist, hat nun mit Beschluss vom 15.07.2025 (Az.: VIII ZB 69/24) für Rechtsklarheit gesorgt.
Die Entscheidung des BGH vom 15.07.2025 (Az. VIII ZB 69/24)
In dem entschiedenen Fall aus Berlin hatte der Vermieter – nach verweigerter Zustimmung des Mieters zur Erhöhung – beim Amtsgericht beantragt, ein schriftliches Sachverständigengutachten über verschiedene wohnwertrelevante Merkmale der Wohnung im selbständigen Beweisverfahren einzuholen. Seine Argumentation: Man habe ein „rechtliches Interesse“ an der Feststellung der ortsüblichen Miete, da so ein künftiger Prozess vermieden werden könne. Das Amtsgericht und in zweiter Instanz das Landgericht Berlin (Kammer 64) wiesen den Antrag jedoch zurück – und der BGH bestätigte diese Entscheidungen vollumfänglich.
Der Bundesgerichtshof stellte klar, dass ein Vermieter grundsätzlich kein rechtliches Interesse daran hat, die ortsübliche Vergleichsmiete für eine Wohnung im Wege eines selbständigen Beweisverfahrens feststellen zu lassen. Ein solches Vorgehen ist unzulässig. Weder die Höhe der ortsüblichen Miete selbst, noch die zugrunde liegenden Wohnwertmerkmale (Ausstattungs- und Lagekriterien, die Zu- oder Abschläge im Mietspiegel bewirken) dürfen vorab gerichtlich begutachtet werden. Der BGH verneint damit die seit Jahren umstrittene Frage und schafft einen Präzedenzfall, der künftig in vergleichbaren Fällen bindend ist.
Zur Begründung verweist der Senat darauf, dass die Durchführung eines selbständigen Beweisverfahrens weder mit der Ausgestaltung des Mieterhöhungsverfahrens (§§ 558 ff. BGB) noch mit dessen Zweck vereinbar sei. Das Gesetz habe im Mieterhöhungsverfahren einen fairen Ausgleich der Interessen von Vermieter und Mieter implementiert. Dieses ausgewogene System – so der BGH – würde unterlaufen, wenn man dem Vermieter gestatten würde, die ortsübliche Miete quasi auf Vorrat gerichtlich ermitteln zu lassen.
Entscheidend ist für den BGH, dass es an einem erforderlichen rechtlichen Interesse im Sinne von § 485 Abs. 2 ZPO fehlt. Zwar erlaubt diese Vorschrift grundsätzlich eine vorzeitige Beweiserhebung, wenn sie der Vermeidung eines Rechtsstreits dienen kann. Im Kontext der Mieterhöhung hält der BGH eine solche vorweggenommene Klärung jedoch nicht für notwendig, um einen Streit zu verhindern Denn das Mietrecht selbst gebe bereits genügend Möglichkeiten, eine gütliche Einigung ohne Prozess zu erzielen. Schon das gesetzliche Erhöhungsverfahren und die vom Vermieter gegebenenfalls zu ergreifenden Schritte (wie z.B. eine Begutachtung der Wohnung durch einen eigenen Sachverständigen und ein gut begründetes Erhöhungsschreiben) sollen dazu beitragen, dass sich Mieter und Vermieter außergerichtlich einigen. Der BGH verweist ausdrücklich darauf, dass ein Vermieter, der ein Gutachten zur Begründung nutzen will, zunächst ohne Gerichtsverfahren die Wohnung mit dem von ihm beauftragten Sachverständigen besichtigen kann. Dabei können die Besonderheiten der konkreten Wohnung berücksichtigt werden, was die Vergleichsmietenermittlung präzisiert und die Bereitschaft des Mieters zur Zustimmung erhöhen kann. Diese außergerichtlichen Schritte erfüllen schon den Zweck der Streitvermeidung, “indem sie die Bereitschaft des Mieters zu einer außergerichtlichen Einigung fördert”. Ein zusätzliches gerichtliches Beweisverfahren ist nach Überzeugung des BGH überflüssig.
Begründung des BGH: Schutzfristen und Kostenrisiken
Der BGH untermauert seine Entscheidung mit detaillierten rechtlichen Erwägungen, die den Schutz des Mieters in den Vordergrund stellen. Zunächst betont das Gericht, dass ein selbständiges Beweisverfahren die gesetzlichen Fristen und Abläufe des Mieterhöhungsverfahrens stören würde. Nach § 558b Abs. 2 BGB hat der Mieter ab Zugang des Erhöhungsverlangens zwei volle Monate Bedenkzeit („Überlegungsfrist“), um in Ruhe zu entscheiden, ob er zustimmt. In dieser Zeit darf der Vermieter keine Klage erheben. Würde man nun erlauben, dass der Vermieter vor oder gleichzeitig mit dem Erhöhungsverlangen bereits ein gerichtliches Gutachten einholt, würde der Mieter faktisch unter Druck gesetzt. Er müsste sich unter Umständen „bereits vor dem Beginn der ihm … zu gewährenden Überlegungsfrist“ zu dem Gutachtenergebnis äußern, um keine Rechte zu verlieren. Hintergrund ist, dass im selbständigen Beweisverfahren oft Fristen zur Stellungnahme gesetzt werden. Lässt der Mieter diese verstreichen, könnte er mit Einwänden gegen das Gutachten im späteren Prozess präkludiert sein (also ausgeschlossen werden). Der Mieter wäre gezwungen, ohne ausreichende Bedenkzeit und ohne die formale Begründung des Vermieters nach § 558a Abs. 1 BGB (die ihm ja gerade eine Orientierungs- und Prüfungsgrundlage geben soll) Stellung zu beziehen. Genau das soll jedoch durch die gesetzlichen Fristen verhindert werden – der Mieter soll vor übereilten Entscheidungen geschützt werden. Der BGH macht deutlich, dass ein selbständiges Beweisverfahren diesen Schutzzweck unterlaufen würde.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Widerspruch zu den Klagefristen. Nach Abschluss eines selbständigen Beweisverfahrens sieht § 494a ZPO vor, dass das Gericht auf Antrag eine Frist zur Erhebung der Hauptsacheklage setzt. Das heißt, der Vermieter müsste dann innerhalb einer vom Gericht bestimmten – meist relativ kurzen – Frist Klage erheben, noch bevor die in § 558b Abs. 2 BGB vorgesehene Überlegungsfrist für den Mieter abgelaufen wäre. Der Gesetzgeber hat aber ausdrücklich bestimmt, dass die dreimonatige Klagefrist des Vermieters erst nach Ablauf der Überlegungsfrist zu laufen beginnt. Würde man den Vermieter schon früher durch § 494a ZPO zur Klage drängen, entstünde ein Konflikt zwischen ZPO und BGB, der zulasten des Mieterschutzes ginge. Der BGH verweist zustimmend auf Stimmen im Schrifttum, die genau dies beanstandet haben.
Selbst wenn man ein selbständiges Beweisverfahren erst nach Ablauf der Überlegungsfrist starten würde, ließe es sich kaum in Einklang mit den Fristen bringen. Denn der Vermieter hat nach verweigerter Zustimmung des Mieters nur drei Monate Zeit, um Klage zu erheben (Ausschlussfrist, § 558b Abs. 2 Satz 2 BGB). Ein Sachverständigenverfahren vor Gericht ist jedoch aufwändig und würde in den seltensten Fällen binnen drei Monaten vollständig abgeschlossen sein. Das bedeutet, der Vermieter müsste trotz laufenden Beweisverfahrens Klage erheben, um die Frist zu wahren – der erhoffte Nutzen der Streitvermeidung ginge verloren. Andernfalls verliehe er sein Mieterhöhungsverlangen, das dann als „nicht gestellt“ gilt.
Schließlich stellt der BGH auf die Kostenfrage ab. Normalerweise muss der Vermieter die Kosten für ein von ihm eingeholtes Gutachten zur Mieterhöhungsbegründung selbst tragen. Diese Kosten werden nicht auf den Mieter abgewälzt, selbst wenn der Mieter der Erhöhung zustimmt oder später in einem Prozess unterliegt – es sind vorprozessuale Kosten des Vermieters. Anders wäre es jedoch, wenn der Vermieter das Gutachten über das Gericht einholt: Dann würden die Gutachterkosten Teil der Prozesskosten. Im Falle eines Obsiegens des Vermieters könnten sie dem Mieter auferlegt werden. Ein solcher Ausgang widerspricht laut BGH dem vom Gesetzgeber gewollten Interessengleichgewicht. Der Mieter soll nicht dadurch schlechter gestellt werden, dass der Vermieter den Gerichtsapparat zur Vorbereitung seiner Mieterhöhung nutzt. Der BGH weist darauf hin, dass der Mieter bei einer außergerichtlichen Gutachteneinholung durch den Vermieter “solche Kosten regelmäßig nicht zu tragen hätte”. Die Durchführung eines gerichtlichen Beweisverfahrens würde diesen Grundsatz aushebeln und den Mieter mit einem zusätzlichen Kostenrisiko belasten, das vom Mietrecht gerade nicht vorgesehen ist.
Zusammenfassend begründet der BGH die Unzulässigkeit also dreifach: Erstens werde der Ablauf des Mieterhöhungsverfahrens mit seinen Schutzfristen für den Mieter durchkreuzt. Zweitens käme es zu Verfahrenskollisionen mit Klagefristen und dem Grundsatz, dass im Mietrecht erst nach Ablehnung des Erhöhungsverlangens geklagt werden darf. Und drittens entstünde ein unbilliges Kostenrisiko zulasten des Mieters, das mit der gesetzlichen Rollenverteilung nicht vereinbar ist. All diese Punkte zeigen, dass es an dem nach § 485 Abs. 2 ZPO erforderlichen “rechtlichen Interesse” des Vermieters fehlt, noch bevor ein Mieterhöhungsprozess überhaupt absehbar ist. Der BGH hält dem entgegen, dass die Vermeidung unnötiger Prozesse bereits durch das Mieterhöhungsverfahren selbst ausreichend gewährleistet wird – zusätzliche gerichtliche Schritte im Voraus seien weder zulässig noch erforderlich.
Praktische Auswirkungen für Vermieter
Für Vermieter bedeutet der BGH-Beschluss eine wichtige Weichenstellung. Künftig ist klar: Ein vorgelagertes gerichtliches Gutachtenverfahren zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete ist nicht erlaubt. Vermieter, die eine Mieterhöhung planen, müssen also auf andere Weise vorgehen, um die ortsübliche Miete zu ermitteln und zu belegen. In der Praxis stehen ihnen hierfür die in § 558a Abs. 2 BGB genannten Begründungsmittel zur Verfügung. So können sie insbesondere auf einen aktuellen Mietspiegel Bezug nehmen oder – falls ein Mietspiegel fehlt oder die Wohnung besondere Merkmale hat – ein privates Sachverständigengutachten in Auftrag geben. Ein solches Gutachten muss von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen stammen und inhaltlich nachvollziehbar begründet sein, damit es im Streitfall vor Gericht als qualifiziertes Beweismittel dienen kann. Wichtig ist: Die Kosten für ein privat beauftragtes Gutachten trägt der Vermieter zunächst selbst. Diese Aufwendungen gelten als Teil seiner gesetzlichen Begründungspflicht und können – anders als Gerichtskosten – nicht im Nachhinein dem Mieter auferlegt werden.
Der BGH-Beschluss verdeutlicht Vermietern zudem, dass sie die gesetzlichen Fristen strikt einhalten müssen. Ein häufiger Fehler in der Vergangenheit war der Versuch, bereits während der Wartefrist oder unmittelbar nach dem Erhöhungsverlangen den “Gang zum Gericht” zu suchen, um Fakten zu schaffen. Nach der neuen Entscheidung ist klar: Vor Ablauf der Überlegungsfrist des Mieters darf kein gerichtliches Verfahren anhängig gemacht werden, das die Mieterhöhung betrifft. Vermieter sollten daher die zweimonatige Frist abwarten und dem Mieter Zeit zur Stellungnahme geben. Sollte der Mieter nicht zustimmen, bleibt dem Vermieter der Klageweg offen – allerdings ohne vorgreifendes Beweisverfahren. Im Klageprozess selbst wird das Gericht dann gegebenenfalls ein Gutachten anordnen. Vermieter sollten beachten, dass das im Prozess eingeholte Gutachten den maßgeblichen Beweis darstellen wird. Ein zuvor vom Vermieter privat eingeholtes Gutachten kann zwar dem Gericht vorgelegt werden, ersetzt aber das Gerichtsgutachten nicht vollwertig. Es kann jedoch indirekt nützlich sein, etwa um die Erfolgsaussichten abzuschätzen oder den Mieter vorab zu überzeugen.
Zeitplanung: Vermieter müssen ihre Mieterhöhungsstrategie nun ohne Rückgriff auf § 485 ZPO ausrichten. Das bedeutet, dass sie im Zweifel frühzeitig – vor Aussprache des Erhöhungsverlangens – eigenständig Erkundigungen zur ortsüblichen Miete einholen sollten (Mietspiegel studieren, ggf. Sachverständigen konsultieren). Es empfiehlt sich, bereits das schriftliche Mieterhöhungsverlangen so fundiert und nachvollziehbar wie möglich zu gestalten. Denn je überzeugender die Begründung (z.B. durch ein qualifiziertes Gutachten mit Wohnungsbesichtigung) ausfällt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mieter zustimmt und ein Rechtsstreit tatsächlich vermieden wird. Hier bestätigt der BGH ausdrücklich den praktischen Ansatz: Der Vermieter kann den Sachverständigen mit Zustimmung des Mieters in die Wohnung lassen, um Besonderheiten festzustellen. Vermieter sollten daher kooperativ vorgehen: den Mieter vorab informieren, warum eine Besichtigung mit einem Experten sinnvoll ist, und um Terminabsprache bitten. Lehnt der Mieter dies ab, muss der Vermieter zwar darauf verzichten, hat dann aber zumindest einen möglichen Einwand weniger, falls es zum Prozess kommt (weil der Mieter dann keine fehlende Berücksichtigung von Wohnwertmerkmalen rügen kann, die er selbst nicht begutachten lassen wollte).
Letztlich schafft der BGH-Beschluss auch Rechtssicherheit: Vermieter sparen sich künftig Zeit und Geld, die sie in unzulässige Verfahren investiert hätten. Versuche, ein Gericht vorab einzuschalten, wären absehbar zum Scheitern verurteilt – Amts- und Landgerichte werden sich an der BGH-Linie orientieren und solche Anträge als unzulässig abweisen. Die richtige Vorgehensweise besteht also darin, das gesetzliche Mieterhöhungsverfahren auszuschöpfen: sorgfältige Begründung, Fristen wahren, und wenn nötig regulär klagen. Dabei sollte man bedenken, dass im gerichtlichen Verfahren die üblichen Kostenregeln gelten – gewinnt der Vermieter, trägt der Mieter die notwendigen Prozesskosten, einschließlich des vom Gericht beauftragten Sachverständigen. Die Kosten eines vorprozessual privat eingeholten Gutachtens bleiben allerdings beim Vermieter. Dies entspricht nun klar der BGH-Vorgabe, vermeidet aber auch böse Überraschungen: Ein Vermieter kann sich nicht mehr darauf verlassen, ein teures Gutachten am Ende auf den Mieter abwälzen zu können. Diese Kosten sollten daher in die Kosten-Nutzen-Abwägung einbezogen werden.
Praktische Auswirkungen für Mieter
Für Mieter ist die Entscheidung des BGH beruhigend. Sie stärkt den Mieterschutz und bestätigt, dass die in § 558 BGB vorgesehenen Fristen und Rechte konsequent eingehalten werden müssen. Ein Mieter muss nun nicht befürchten, vom Vermieter kurzerhand in ein gerichtliches Beweisverfahren verwickelt zu werden, bevor er überhaupt formell zu einer Mieterhöhung Stellung nehmen konnte. Die „Warte-“ und „Überlegungsfristen“ erfüllen ihren Sinn: Der Mieter hat ausreichend Zeit, das Erhöhungsverlangen zu prüfen – sei es durch Einsicht in den Mietspiegel, Rücksprache mit einem Mieterverein oder eigene Recherchen. Er kann die Begründung des Vermieters in Ruhe auf Plausibilität überprüfen. Sollte der Vermieter seiner Begründung ein Privatgutachten beigefügt haben, kann der Mieter dieses ebenfalls kritisch würdigen oder fachkundigen Rat einholen, ohne unter sofortigem gerichtlichen Druck zu stehen.
Lehnt der Mieter die Mieterhöhung ab, weiß er nun, dass der Vermieter zunächst klagen muss und im Prozess dann das Gericht für die Einholung eines Gutachtens zuständig ist. Der Mieter wird erst im Rahmen des Gerichtsverfahrens mit einem gerichtlich bestellten Sachverständigen konfrontiert – und auch nur, wenn es tatsächlich zum Prozess kommt. Dadurch kann der Mieter vorher abschätzen, ob der Vermieter wohl ausreichend Belege hat, und gegebenenfalls doch noch außergerichtlich eine Einigung suchen. Wichtig zu wissen: Die Kosten eines gerichtlichen Verfahrens trägt der Mieter nur im Unterliegensfall. Wenn also der Mieter die Erhöhung zu Unrecht verweigert hat und der Vermieter im Prozess obsiegt, muss der Mieter die Gerichtskosten und auch die Kosten des gerichtlichen Sachverständigen tragen. Verzichtet der Vermieter aber auf eine Klage (z.B. weil das Gutachten für ihn ungünstig ausfiel oder andere Gründe), entstehen dem Mieter keine gerichtlichen Kosten. Hätte der Vermieter – entgegen der neuen Rechtslage – versucht, über ein selbständiges Beweisverfahren vorzugehen, wäre die Situation für den Mieter heikler gewesen: Er hätte bei Unterliegen eventuell sogar die frühzeitig angefallenen Gutachterkosten tragen müssen. Dies ist nun ausgeschlossen.
Die Entscheidung schafft somit Chancengleichheit: Der Mieter ist nicht gezwungen, proaktiv Einwände in einem Vorverfahren zu erheben, sondern kann abwarten, bis der Vermieter alle gesetzlichen Schritte eingehalten hat. Er muss sich erst äußern, wenn er das vollständige Erhöhungsverlangen vor sich hat und die gesetzlichen zwei Monate Bedenkzeit nutzen konnte. Auch kann er sicher sein, dass keine versteckten Fristen aus einem vorgeschalteten Verfahren laufen, die seine Rechte beschneiden. Sollte ein Vermieter dennoch versuchen, Druck aufzubauen mit Sätzen wie „Dann hole ich eben ein Gerichtsgutachten ein“, kann der Mieter gelassen auf den BGH-Beschluss verweisen. Ein solcher Schritt wäre unzulässig und wird von den Gerichten nicht mehr beschritten.
Zudem behalten Mieter die Gewissheit, dass sie für vorprozessuale Gutachterkosten nicht aufkommen müssen. Wenn der Vermieter ein eigenes Gutachten zur Begründung beauftragt, trägt er die Kosten dafür selbst – der Mieter muss dafür nicht aufkommen, selbst wenn er später der Erhöhung zustimmt oder im Prozess verliert. Die finanzielle Hürde, einen Gutachter einzuschalten, liegt also weiterhin beim Vermieter, was dem Mieter indirekt zugutekommt: Vermieter werden sich gut überlegen, ob sie ein teures Privatgutachten in Auftrag geben oder lieber den örtlichen Mietspiegel als Basis nehmen. Für den Mieter bedeutet dies, dass Mieterhöhungsverlangen in vielen Fällen auf transparenten Kriterien (Mietspiegel) beruhen werden, statt auf schwer nachprüfbaren Gutachten.
Abschließend stärkt der BGH-Beschluss die außergerichtliche Einigungskultur im Mietrecht. Beide Parteien – Vermieter wie Mieter – werden angehalten, im Rahmen des formalisierten Mieterhöhungsverfahrens zu einer Lösung zu finden, ohne vorschnell das Gericht anzurufen. Mieter können darauf vertrauen, dass ihre Rechte im Vorfeld gewahrt werden, und Vermieter wissen, dass nur ein gut vorbereiteter und begründeter Erhöhungsantrag Aussicht auf Zustimmung hat. Kommt es doch zum Prozess, so auf gleicher Augenhöhe und ohne dass eine Seite durch ein Vorab-Gutachten im Vorteil oder Nachteil wäre. Der BGH hat mit seinem Beschluss vom 15.07.2025 somit für mehr Rechtssicherheit und Fairness im Mieterhöhungsrecht gesorgt – ein Rechtstipp, den Vermieter und Mieter gleichermaßen beherzigen sollten.