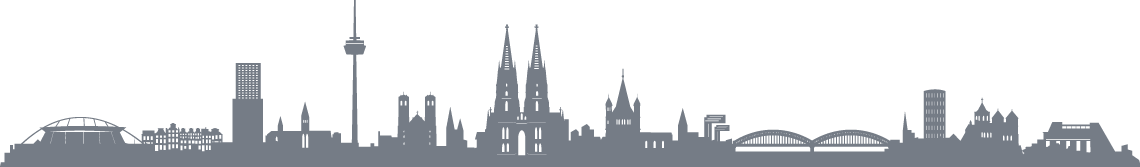In einer praxisrelevanten Entscheidung hat der Bundesgerichtshof (BGH) am 16. April 2025 (Az. VIII ZR 270/22) den Maßstab für die Darlegung gesundheitlicher Härtegründe im Zusammenhang mit einer Eigenbedarfskündigung konkretisiert. Die Entscheidung stärkt die Position von Mieterinnen und Mietern, verpflichtet aber auch Vermieter und Gerichte zu einer sorgfältigeren Abwägung im Räumungsprozess.
Worum ging es in dem Fall?
Die beklagte Mieterin bewohnte seit mehreren Jahren eine Mietwohnung, die ihr von einer privaten Vermieterin zur Verfügung gestellt wurde. Diese kündigte das Mietverhältnis mit der Begründung, sie benötige die Wohnung für ihren Sohn – ein klassischer Fall der Eigenbedarfskündigung gemäß § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB.
Die Mieterin widersprach der Kündigung unter Berufung auf gesundheitliche Härtegründe (§ 574 BGB). Sie legte ärztliche Atteste vor, die unter anderem auf eine schwere Angststörung sowie auf depressive Episoden verwiesen. Ein Umzug würde laut ärztlicher Stellungnahme eine erhebliche Verschlechterung ihres Gesundheitszustands bewirken. Die Vorinstanzen – Amts- und Landgericht – ließen diesen Vortrag jedoch nicht gelten und bejahten die Räumungspflicht.
Kernaussage des BGH: Maßstab für Härtegründe nicht überspannen
Der BGH hob die Entscheidungen auf und stellte klar:
„Der Mieter genügt seiner Darlegungslast, wenn er nachvollziehbare Angaben zu seinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen macht und diese durch ärztliche Bescheinigungen stützt. Eine umfassende medizinische Beweisführung ist auf dieser Stufe nicht erforderlich.“
– BGH, Urt. v. 16.04.2025 – VIII ZR 270/22
Damit stellt der BGH klar: Die Schwelle für die Geltendmachung eines Widerspruchs nach § 574 BGB darf nicht so hoch angesetzt werden, dass der Kündigungsschutz leerläuft. Es sei Aufgabe des Gerichts, gegebenenfalls durch eigene Beweiserhebung – etwa durch Sachverständigengutachten – zu prüfen, ob eine Härte tatsächlich vorliegt.
Was bedeutet das für Mieter:innen?
✅ Rechte werden gestärkt: Wer gesundheitlich stark beeinträchtigt ist, muss keine aufwändigen medizinischen Expertisen vorlegen, um den Widerspruch gegen eine Kündigung zu begründen. Es reicht eine nachvollziehbare Darstellung – idealerweise gestützt durch ärztliche Atteste.
✅ Mehr Sicherheit bei Krankheit und Gebrechlichkeit: Gerade ältere, chronisch kranke oder psychisch stark belastete Mieter können sich wirksam gegen eine Eigenbedarfskündigung wehren.
✅ Form und Inhalt beachten: Dennoch sollten Mieter auf eine strukturierte Darstellung ihrer Situation achten. Eine bloße Behauptung von gesundheitlichen Nachteilen ohne medizinische Grundlage wird nicht genügen.
📌 Praxistipp: Lassen Sie sich frühzeitig durch eine Mietrechtsberatung unterstützen. Je früher ärztliche Bescheinigungen eingeholt und strukturiert vorgelegt werden, desto besser sind die Erfolgsaussichten.
Was bedeutet das für Vermieter:innen?
🔍 Eigenbedarf muss weiterhin anerkanntes Interesse sein: Vermieter müssen einen nachvollziehbaren und plausibel dargelegten Eigenbedarf vortragen. Die Schwelle zur Eigenbedarfskündigung wurde durch das Urteil nicht erhöht.
⚠️ Erhöhte Anforderungen bei Widerspruchsprüfung: Wird der Kündigung widersprochen, etwa aus gesundheitlichen Gründen, muss der Widerspruch ernst genommen werden. Pauschale Zurückweisungen können im Prozess nach hinten losgehen.
📜 Dokumentation ist entscheidend: Wenn Vermieter die Eigenbedarfskündigung gut begründen und dokumentieren, stehen die Chancen auf eine Räumung nicht schlecht – aber der soziale Ausgleich wird stärker gewichtet.
📌 Praxistipp: Sollte ein Widerspruch erfolgen, empfiehlt sich anwaltliche Unterstützung, um den Vortrag der Gegenseite richtig einzuordnen und rechtlich zu würdigen. Die Einschaltung medizinischer Sachverständiger kann erforderlich sein.
Gerichtliche Pflichten: Hinzuziehung von Sachverständigen
Der BGH hebt in seinem Urteil hervor, dass die Gerichte von Amts wegen tätig werden müssen, wenn eine ernsthafte gesundheitliche Härte im Raum steht. Dies bedeutet:
-
Das Gericht darf sich nicht pauschal auf Zweifel an der Richtigkeit eines ärztlichen Attests berufen.
-
Liegen substanzielle Hinweise auf Gesundheitsgefahren durch einen Umzug vor, muss das Gericht ein medizinisches Gutachten einholen, bevor es eine Entscheidung trifft.
Fazit: Mehr Abwägung, mehr Schutz
Mit dieser Entscheidung stellt der BGH klar: Kündigungsschutz ist kein bloßes Lippenbekenntnis. Der Gesetzgeber wollte mit § 574 BGB Härtefälle sozial abfedern – und das muss sich auch in der gerichtlichen Praxis widerspiegeln.
Die Rechte von Mieterinnen und Mietern, die aufgrund ihres Gesundheitszustands besonders schutzbedürftig sind, wurden gestärkt. Gleichzeitig behalten Vermieter ihr legitimes Interesse an der Eigenbedarfskündigung – müssen jedoch stärker mit der menschlichen Dimension des Wohnens rechnen.