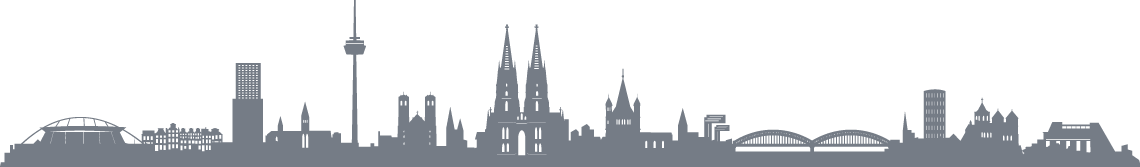Moderne Wohnanlage: Bei Mehrheitsbeschlüssen der WEG müssen alle Eigentümer mitziehen.
Worum ging es?
In einem aktuellen Fall hat ein Wohnungseigentümer mehrere Beschlüsse seiner Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) angefochten, weil ihm die Vorschusszahlungen für bevorstehende Ausgaben zu hoch erschienen. Die Eigentümerversammlung hatte im Jahr 2022 unter anderem 1.500 € für die Anmietung eines Fahrradkellers, 3.000 € als zusätzliche Vergütung für die neue Verwalterin, 12.000 € für erwartete Rechtsberatungskosten sowie eine Erhöhung der Erhaltungsrücklage um 20.000 € beschlossen. Der klagende Eigentümer hielt diese Beträge für übersetzt und wollte den Beschluss für ungültig erklären lassen. Sowohl das Amts- und Landgericht als Vorinstanzen als auch der Bundesgerichtshof (BGH) gaben ihm jedoch nicht recht. Im Urteil vom 26.09.2025 (Az. V ZR 108/24) stellte der BGH klar, dass einzelne Wohnungseigentümer sich auch dann mit den Mehrheitsentscheidungen abfinden müssen, wenn es für sie teuer wird.
Was hat der BGH entschieden?
Der BGH bestätigte, dass der Eigentümerversammlung bei Beschlüssen über Hausgeldvorschüsse ein weiter Gestaltungsspielraum zusteht. Sowohl die Auswahl der im Wirtschaftsplan berücksichtigten Kostenpositionen als auch deren Höhe unterliegen einem erheblichen Ermessen der Gemeinschaft. Ein Beschluss über die Vorauszahlungen ist daher nur ausnahmsweise anfechtbar, nämlich allenfalls dann, wenn im Zeitpunkt des Beschlusses offensichtlich weit überhöhte oder deutlich zu niedrige Beiträge festgesetzt wurden. Mit anderen Worten: Solange die beschlossenen Vorschüsse nicht evident unangemessen sind, bewegen sie sich im Rahmen ordnungsmäßiger Verwaltung und bleiben gültig.
Der BGH hob insbesondere hervor, dass dies auch für die Höhe der Zuführung zur Erhaltungsrücklage gilt. Wohnungseigentümer sind gesetzlich verpflichtet, eine angemessene Instandhaltungsrücklage zu bilden (vgl. § 19 Abs. 2 Nr. 4 WEG). Dabei muss kein konkreter Reparaturbedarf bereits vorliegen, um Geld für künftige Instandsetzungen zurückzulegen. Der weite Ermessensspielraum erlaubt es der Gemeinschaft, vorsorglich auch höhere Beiträge in die Rücklage einzustellen, ohne dass dies allein einen Anfechtungsgrund darstellt.
Zugleich stellte der BGH klar, dass bei der Planung der Ausgaben mit gesundem Augenmaß vorzugehen ist. Ein Wirtschaftsplan stellt immer eine Prognose der voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben des kommenden Jahres dar. Die Eigentümer dürfen hierbei alle feststehenden oder zu erwartenden Kosten einstellen. Sie können aus Vorsicht sogar großzügige Ansätze wählen, um spätere Nachforderungen zu vermeiden. Maßgeblich ist, dass die Schätzungen nachvollziehbar und vertretbar sind – nicht zwingend, dass sie sich im Nachhinein als punktgenau zutreffend erweisen. Selbst wenn einzelnen Posten ein Vertrag zugrunde liegt, der später als unwirksam angesehen werden könnte, dürfen diese Kosten vorläufig eingeplant werden. Laut BGH ist bei der Kalkulation grundsätzlich von der Wirksamkeit bestehender Verpflichtungen auszugehen, bis etwas anderes feststeht. Das bedeutet z.B., dass die Mietkosten für den Fahrradkeller im Wirtschaftsplan berücksichtigt werden dürfen, auch wenn ein Eigentümer den Mietvertrag für nichtig hält – die Prüfung der Vertragswirksamkeit gehört nicht in das Anfechtungsverfahren des Wirtschaftsplans.
Was bedeutet das für Wohnungseigentümer?
Für Wohnungseigentümer heißt das Urteil vor allem: Mehrheitsbeschlüsse über Hausgeld und Sonderumlagen sind hinzunehmen, solange diese sich im Rahmen der üblichen und vernünftigen Verwaltung bewegen. Einzelne Eigentümer haben nur geringe Chancen, sich gegen die Höhe der beschlossenen Vorauszahlungen zu wehren. Persönlich als hoch empfundene Zahlungen – sei es für Reparaturrücklagen, geplante Sanierungen oder gemeinsame Anschaffungen – reichen allein nicht aus, um einen Beschluss gerichtlich zu kippen. Nur wenn der Beitrag objektiv krass überzogen ist (oder umgekehrt viel zu niedrig angesetzt, was die Finanzierbarkeit gefährden würde), kommt eine Anfechtung in Betracht.
Praktisch bedeutet das: Eigentümer sollten bereits in der Versammlung ihre Bedenken sachlich vorbringen, um die Mehrheit vielleicht noch umzustimmen. Kommt es dennoch zum Beschluss, muss man ihn binnen eines Monats gerichtlich anfechten (§ 45 WEG) – andernfalls wird er bestandskräftig. Die Hürden vor Gericht sind jedoch hoch. Ein Gericht wird den Wirtschaftsplan nur dann für ungültig erklären, wenn z.B. offenkundig unrealistische Zahlen ohne plausible Grundlage beschlossen wurden. Subjektive Unzufriedenheit oder finanzielle Härten einzelner zählen vor Gericht nicht als Anfechtungsgrund, solange der Beschluss insgesamt vertretbar ist. Jeder Wohnungseigentümer muss also damit rechnen, von der Mehrheit überstimmt zu werden und dann trotzdem zahlen zu müssen. Dies gehört gewissermaßen zum „Spielregeln“ einer Gemeinschaft: Mehrheit ist Mehrheit, und gemeinschaftliche Ausgaben müssen von allen getragen werden. Wer solche Kosten grundsätzlich scheut, sollte die finanziellen Verpflichtungen beim Erwerb von Wohnungseigentum nicht unterschätzen.
Allerdings haben Eigentümer auch Rechte: Sollte tatsächlich ein evident unverhältnismäßiger Beschluss gefasst werden – etwa ein überdimensionaler Sonderumlagebetrag ohne jegliche Notwendigkeit – können und sollten sie den Rechtsweg beschreiten. Auch formelle Fehler (z.B. Beschluss ohne gültige Einladung oder falsche Berechnung der Verteilungsschlüssel) können einen Beschluss angreifbar machen. In solchen Fällen ist rechtzeitiger juristischer Rat sinnvoll. Im Normalfall aber gilt: Beschlossene Vorschüsse sind zu zahlen, und eventuelle Abrechnungsüberschüsse kommen später der Gemeinschaft (etwa durch Einzahlung in die Rücklage oder Verrechnung in der Jahresabrechnung) wieder zugute.
Was bedeutet das für Verwaltungen?
Für WEG-Verwalter und Verwaltungsbeiräte bestätigt der BGH die bereits geübte Praxis: Sie haben bei der Erstellung des Wirtschaftsplans einen weiten Spielraum, um die Gemeinschaft finanziell solide aufzustellen. Erwartete Ausgaben sollten vollständig und vorsichtig kalkuliert in den Plan aufgenommen werden. Dabei ist es zulässig – ja sogar geboten – ausreichende Rücklagen und Reserven einzuplanen, damit die Gemeinschaft handlungsfähig bleibt. Der BGH betont, dass vorsorgliche Ansätze nicht nur erlaubt, sondern Teil einer ordnungsmäßigen Verwaltung sind. Verwalter sollten dies den Eigentümern transparent erläutern: Zum Beispiel kann eine höhere Rücklage oder eine Sonderumlage für ein bevorstehendes Projekt damit begründet werden, dass spätere plötzliche Nachzahlungen vermieden werden sollen. Die Entscheidung zeigt auch, dass die Gerichte Verwaltungshandeln mit Augenmaß schützen: Solange der Wirtschaftsplan auf realistischen Annahmen beruht und dem Gemeinschaftsinteresse dient, steht die Rechtsprechung hinter der Gemeinschaftsentscheidung.
Für die Verwaltungspraxis bedeutet das Urteil aber nicht, dass man beliebig hohe Zahlungen „durchwinken“ kann. Sorgfalt und Dokumentation bleiben wichtig. Verwalter sollten Bedarfe gut begründen und nachvollziehbar herleiten, um den Eigentümern die Höhe der Umlagen verständlich zu machen. Je besser größere Posten (z.B. ein erhöhter Rechtskostenansatz oder ein umfangreiches Sanierungsbudget) im Vorfeld erklärt werden, desto eher findet sich die nötige Mehrheit – und desto geringer ist das Risiko einer Anfechtungsklage. Auch wenn die Erfolgschancen für Kläger gering sind, verursacht ein Rechtsstreit Aufwand und Kosten für die Gemeinschaft. Daher ist es im Interesse aller, Beschlüsse einvernehmlich und rechtssicher zu gestalten.
Verwaltungen sollten zudem beachten, dass gesetzliche Pflichten eingehalten werden: Etwa die Pflicht zur Bildung einer angemessenen Instandhaltungsrücklage. Unterlässt die Mehrheit dies über längere Zeit, könnten umgekehrt sorgfältige Eigentümer einen Beschluss erzwingen, um die Substanz des Gebäudes zu erhalten. Das BGH-Urteil erinnert also beide Seiten daran, verantwortungsbewusst mit dem Mehrheitsprinzip umzugehen: Die Verwaltung hat Spielraum, diesen aber im Sinne einer vorausschauenden und fairen Finanzplanung zu nutzen.
Gibt es Grenzen für Mehrheitsbeschlüsse?
Trotz des weiten Ermessensspielraums gibt es Grenzen, die Mehrheitsentscheidungen in der WEG einhalten müssen. Kein Beschluss darf gegen zwingendes Recht oder die Gemeinschaftsordnung verstoßen. Beispielsweise kann die Eigentümermehrheit nicht willkürlich den Verteilungsschlüssel ändern oder einzelne Eigentümer ungleich belasten, ohne dass das Gesetz (§ 16 WEG) dies erlaubt. Solche diskriminierenden oder gesetzeswidrigen Beschlüsse wären von Anfang an nichtig oder anfechtbar. Auch ein Wirtschaftsplan, der völlig am tatsächlichen Bedarf vorbeigeht – etwa eine völlig überzogene Finanzplanung ohne Sachgrund – überschreitet das erlaubte Ermessen. Der BGH spricht hier von „weit überhöhten“ Ansätzen, die evident unvertretbar sind. In der Praxis ist diese Schwelle jedoch hoch: Solange ein Beschluss sich noch sachlich begründen lässt, wird man ihn hinnehmen müssen.
Eine weitere Grenze ergibt sich aus dem Grundsatz ordnungsmäßiger Verwaltung (§ 18 WEG). Die Mehrheit darf zwar auch gegen den Willen einzelner entscheiden, muss aber stets das Wohl der Gemeinschaft im Auge behalten. Entscheidungen, die der Gemeinschaft schaden statt nützen, wären nicht ordnungsmäßig. So dürfte die Mehrheit keine Vorschusszahlung beschließen, die erkennbar völlig unnötig ist oder nur dazu dient, einen unbeliebten Eigentümer zu schikanieren – in solchen Fällen könnte der Betroffene erfolgreich vorgehen. Ebenso wenig darf die Mehrheit dauerhaft notwendige Ausgaben verweigern (etwa dringend nötige Reparaturen jahrelang vertagen), da auch das die Grenzen ihres Ermessens überschreitet.
Das Mehrheitsprinzip im WEG-Recht geht weit, aber nicht grenzenlos. Normale und auch höhere Umlagen sind rechtlich zulässig und für alle verbindlich. Unzulässig wird es erst, wenn die Entscheidung jedem vernünftigen Maßstab widerspricht oder gegen klare Regeln verstößt. Wohnungseigentümer sollten diese Spielregeln kennen: Mehrheitsbeschlüsse haben eine starke Bindungswirkung, doch im Ausnahmefall bietet das Rechtsschutzsystem Korrekturmöglichkeiten – allerdings nur innerhalb enger Grenzen und kurzer Fristen. So trägt das Urteil des BGH letztlich zur Rechtssicherheit und Berechenbarkeit in WEG-Gemeinschaften bei: Alle wissen, woran sie sind – hohe Vorschüsse eingeschlossen.