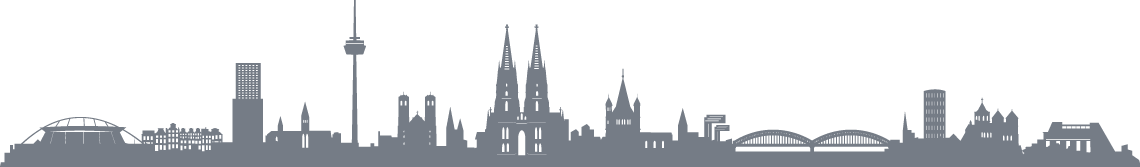Der Bundesgerichtshof (BGH) hat im Juni 2025 erneut einen Nachbarschaftsstreit entschieden. Im Fokus stand die Frage, von wo aus die Höhe von Bäumen und Sträuchern gemessen wird, wenn die Grundstücke verschieden hoch liegen. Das Urteil bringt Klarheit und wichtige Hinweise für Grundstückseigentümer und Nachbarn.
Sachverhalt: Höhenunterschied sorgt für Nachbarschaftsstreit
In dem Fall stritten Nachbarn aus Baden-Württemberg um die zulässige Höhe mehrerer Pflanzen an der gemeinsamen Grundstücksgrenze. Das Grundstück der Beklagten (Pflanzenbesitzer) liegt etwa einen Meter höher als das Grundstück der klagenden Nachbarn. Bereits 1994 wurde beim Bau des Hauses der Beklagten ihr Grundstück im hinteren Bereich um einen Meter aufgeschüttet. Entlang der Grenze stehen auf dem höher liegenden Grundstück der Beklagten unter anderem ein portugiesischer Lorbeerbaum, ein Fliederbaum, eine Kreppmyrte und ein Rosenstrauch.
Mit der Zeit wuchsen diese Gewächse immer höher, was die tieferliegenden Nachbarn störte. Sie forderten, alle Pflanzen jährlich zwischen Oktober und Februar auf 1,80 m Höhe zurückzuschneiden, gemessen vom niedrigeren Bodenniveau ihres eigenen Grundstücks. Die beklagten Pflanzenbesitzer hielten dem entgegen, dass einige ihrer Bäume die zulässige Höhe noch gar nicht überschritten hätten – je nachdem, von welchem Geländepunkt aus man die Höhe misst.
Gesetzliche Höhenbegrenzungen nach dem Nachbarrecht (BW)
Das Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg (NRG BW) schreibt Grenzabstände für Bäume, Sträucher und andere Gehölze sowie maximale Wuchshöhen bei Unterschreitung dieser Abstände vor. Je näher an der Grundstücksgrenze gepflanzt wird, desto niedriger muss die Pflanze gehalten werden: So dürfen bestimmte Gehölze bei einem Abstand bis zu 2 m zur Grenze höchstens 1,80 m hoch sein; bei einem Abstand bis zu 3 m sind 4 m Höhe zulässig. Wird diese zulässige Höhe überschritten, hat der Nachbar einen Anspruch auf Rückschnitt der Pflanze. Wichtig zu wissen: In Baden-Württemberg dürfen Rückschnitte nur zwischen 1. Oktober und Ende Februar erfolgen, um z.B. Vogelschutzzeiten einzuhalten. Dieser Kürzungsanspruch des Nachbarn verjährt auch nicht (so bestimmt es § 26 Abs. 3 NRG BW).
Im entschiedenen Fall bedeuteten diese Vorgaben konkret: Der Lorbeerbaum durfte bis zu 4 m hoch wachsen, während für den Rosenstrauch, den Flieder und die Kreppmyrte jeweils 1,80 m als Höchstmaß galten.
Streitfrage: Von welchem Bodenniveau wird gemessen?
Kern des Streits war, von welchem Bezugspunkt aus die Wuchshöhe gemessen wird, wenn ein Grundstück höher liegt als das andere. Die Kläger (unteres Grundstück) meinten, maßgeblich sei ihr tiefer liegendes Bodenniveau – dadurch wären die Pflanzen effektiv um 1 m höher und überschritten die Grenzen deutlich. Die Beklagten (höheres Grundstück) argumentierten, es komme auf den Punkt an, wo die Pflanze aus dem Boden tritt, also ihr eigenes, höheres Bodenniveau.
Die Vorinstanzen urteilten uneinheitlich: Das Amtsgericht Freiburg gab den Nachbarn zwar Recht auf Rückschnitt, wollte die Höhe jedoch vom Austrittspunkt der Pflanze aus dem Boden messen (also ab Boden der Beklagten). Das Landgericht Freiburg sah es anders und legte das niedrigere Bodenniveau der Kläger als Bezugspunkt zugrunde. Dadurch erhöhte sich rechnerisch die gemessene Höhe um den einen Meter Höhenunterschied. Welche Sichtweise ist korrekt? Darüber musste schließlich der BGH entscheiden.
Entscheidung des BGH: Maßgeblich ist der eigene Boden der Pflanze
Der BGH (V. Zivilsenat) stellte klar, dass die zulässige Wuchshöhe immer vom Boden des Grundstücks gemessen wird, auf dem die Pflanze steht. Es gilt also der Grundsatz: Eine Pflanze ist so hoch, wie sie aus ihrem Boden herausragt. Dies entspricht dem bereits in einem früheren BGH-Fall (zur Bambushecke) entwickelten Prinzip. Egal ob das Nachbargrundstück höher oder tiefer liegt – die Höhe wird am Stamm bzw. Trieb an der Austrittsstelle aus dem Erdreich gemessen.
Damit korrigierte der BGH die Ansicht des Landgerichts. Nachbar A kann von Nachbar B nicht verlangen, eine Pflanze darüber hinaus zu kürzen, nur weil sein eigenes Grundstück tiefer liegt. Entscheidend ist allein, ob die Pflanze gemessen ab ihrem eigenen Boden die zulässige Höhengrenze überschreitet.
Beispiel aus dem Urteil: Der Lorbeerbaum hatte vom Austrittspunkt gemessen eine Höhe von ca. 3,05 m – zulässig wären bis 4 m gewesen. Der Rosenstrauch maß 1,60 m – zulässig 1,80 m. Beide hielten somit die Vorgaben ein und mussten nicht gekürzt werden. Der Fliederbaum (2,05 m hoch) und die Kreppmyrte (1,90 m hoch) überschritten hingegen ihre erlaubten 1,80 m und mussten auf 1,80 m zurückgeschnitten werden. Allerdings – und das ist wesentlich – wird auch hier die 1,80 m ab dem Boden der Beklagten gemessen, nicht ab dem tieferen Nachbargrundstück.
Keine Tricks durch Aufschütten des Geländes
Der BGH betonte zugleich, dass „Tricksereien“ bei der Messhöhe unzulässig sind. Würde ein Grundstückseigentümer im Zusammenhang mit der Pflanzung absichtlich Erde aufschütten oder einen künstlichen Wall an der Grenze errichten, nur um die Messung der Höhe zu seinen Gunsten zu beeinflussen, ließe man dies nicht gelten. In einem solchen Fall wäre ausnahmsweise das ursprüngliche Geländeniveau maßgeblich. Im konkreten Fall gab es dafür jedoch keine Anhaltspunkte – die Aufschüttung auf dem Grundstück der Beklagten stammte von der Bebauung vor ~30 Jahren und diente erkennbar nicht dem Zweck, die Nachbarrechts-Vorschriften zu umgehen. Entsprechend blieb es hier bei der normalen Regel: gemessen wird ab aktueller Bodenoberfläche des Pflanzenstandorts.
Was bedeutet das für Nachbarn?
Mit diesem Urteil hat der BGH die Rechtslage bei unterschiedlichen Geländeniveaus geklärt. Für Nachbarn bedeutet dies: Maßgeblich ist der Boden des Grundstücks, auf dem die Pflanze wächst, unabhängig davon, ob dieses höher oder tiefer liegt als das Nachbargrundstück. Nachbarrechte werden also “grundstücksbezogen” gemessen. Wer auf seinem höher gelegenen Grundstück nahe der Grenze Bäume oder Hecken pflanzt, muss die Höhenvorgaben nur in Bezug auf den eigenen Boden einhalten. Umgekehrt kann der tiefer liegende Nachbar keine zusätzliche Kürzung verlangen, nur weil sein Grundstück tiefer ist.
Allerdings: Grundstückseigentümer sollten es gar nicht erst zu solchen Streitigkeiten kommen lassen. Es empfiehlt sich, beim Bepflanzen der Grundstücksgrenze die Landes-Nachbarrechtsgesetze zu beachten – diese regeln genau, welchen Abstand und welche Höhe verschiedene Gewächse einhalten müssen. Die Vorschriften können je nach Bundesland variieren. Im Zweifel sollte man seine Bepflanzung etwas niedriger halten oder mit dem Nachbarn abstimmen, um den Hausfrieden zu wahren. Falls es doch zum Konflikt kommt, bietet das Nachbarrecht klare Ansprüche: Überragend hohe Gewächse dürfen gekürzt werden – aber eben gemäß den objektiven Maßstäben (Abstand, Höhe, Messpunkt) und nicht nach subjektivem Empfinden. Das aktuelle BGH-Urteil sorgt insoweit für Rechtssicherheit und faire Maßstäbe im nachbarlichen Miteinander.