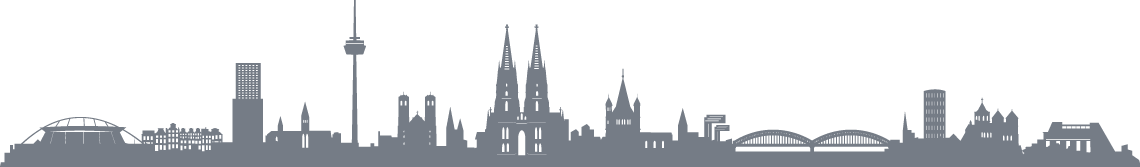Hintergrund des Falls (BGH VIII ZR 291/23)
Im entschiedenen Fall hatten ein Vermieter und ein Mieter in ihrem Wohnraummietvertrag vereinbart, dass beide Seiten für die Dauer von fünf Jahren auf ihr ordentliches Kündigungsrecht verzichten. Dennoch kündigte der Mieter bereits nach acht Monaten zum Ende des ersten Mietjahres den Mietvertrag. Der Vermieter akzeptierte diese Kündigung nicht und weigerte sich, die Wohnung zurückzunehmen. Wichtig zu wissen: Nach ständiger BGH-Rechtsprechung ist ein formularmäßiger Kündigungsverzicht von mehr als vier Jahren in Wohnraummietverträgen in der Regel unwirksam. Daher stellte sich heraus, dass die Kündigung des Mieters wirksam war – was jedoch erst zwei Jahre später gerichtlich festgestellt wurde.
Während dieser zwei Jahre lagerte der Mieter noch für fünf Monate einige Möbel (u.a. eine Einbauküche) in der strittigen Wohnung ein, wohnte aber bereits anderswo. Für diese 5 Monate zahlte er die vereinbarte Miete „unter Vorbehalt“, also mit dem Vorbehalt, das Geld zurückzufordern, falls sich seine Kündigung als wirksam erweisen sollte. Nach Ablauf dieser Zeit stellte der Mieter die Mietzahlungen vollständig ein, da er die Wohnung nicht mehr nutzte und von der Wirksamkeit seiner Kündigung ausging. Daraufhin sprach der Vermieter seinerseits eine außerordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs aus.
Im anschließenden Rechtsstreit verlangte der Mieter die Rückzahlung der von ihm unter Vorbehalt gezahlten Mieten sowie die Rückerstattung der Kaution. Der Vermieter forderte dagegen eine Nutzungsentschädigung in Höhe der vereinbarten Miete für die Zeit nach dem ersten Kündigungstermin, in der der Mieter die Wohnung nicht mehr bewohnte. Das Amtsgericht gab der Klage des Mieters überwiegend statt und wies die Forderung des Vermieters weitgehend ab. Der Vermieter unterlag auch in der Berufung und letztinstanzlich vor dem BGH (Urteil vom 18.06.2025 – VIII ZR 291/23).
Entscheidung des BGH: Leitsätze und rechtliche Würdigung
Der Bundesgerichtshof bestätigte mit diesem Urteil zentrale Grundsätze des Mietrechts und stellte praxisrelevante Leitlinien auf:
- Voraussetzung des Vorenthaltens nach § 546a BGB: Ein Vermieter kann nach § 546a Abs. 1 BGB nur dann eine Nutzungsentschädigung verlangen, wenn der Mieter die Mietsache nach Vertragsende nicht zurückgibt und diese Zurückbehaltung dem Willen des Vermieters widerspricht. Mit anderen Worten: Der Mieter muss dem Vermieter die Wohnung vorenthalten, indem er sie trotz Verlangen nicht herausgibt. Fehlt es an einem solchen Rückgabeverlangen des Vermieters, liegt kein Vorenthalten im Sinne der Vorschrift vor.
- Kein Nutzungsentschädigungsanspruch ohne Rücknahmewillen des Vermieters: Im vorliegenden Fall hatte der Vermieter die Rückgabe der Wohnung gar nicht eingefordert, weil er irrtümlich vom Fortbestand des Mietverhältnisses ausging. Der BGH stellte klar, dass in einer solchen Konstellation kein Anspruch auf Nutzungsentschädigung nach § 546a BGB besteht, da der Mieter die Wohnung mangels Rückforderungsverlangen nicht „vorenthält“. Diese Auslegung sei auch interessengerecht, so der BGH, denn andernfalls müsste der Mieter unabhängig vom Prozessausgang über die Kündigung ständig Miete zahlen – entweder als Mietzins nach § 535 Abs. 2 BGB oder als Entschädigung nach § 546a Abs. 1 BGB. Eine solche doppelte Zahlungsverpflichtung bis zur Klärung der Kündigungswirksamkeit wäre unbillig. Folge: Hat der Vermieter keinen erkennbaren Willen, die Mieträume zurückzuerhalten (z.B. weil er auf Vertragsfortsetzung beharrt), kann er keine Nutzungsentschädigung nach § 546a BGB verlangen.
- Ansprüche aus Bereicherungsrecht statt voller Miete: Dem Vermieter bleibt in solchen Fällen nur der Weg über das Bereicherungsrecht. So konnte der Vermieter hier seine Forderung lediglich bereicherungsrechtlich geltend machen, weil der Mietvertrag als Rechtsgrund für weitere Zahlungen entfallen war. Konkret bedeutet das: Der Mieter schuldet dem Vermieter einen Wertersatz für die tatsächliche Nutzung, aber nicht automatisch die volle vereinbarte Miete. Entscheidend ist der tatsächliche Nutzungswert, den der Mieter aus der weiteren Vorenthaltung der Wohnung gezogen hat (§ 818 Abs. 2 BGB). Im besprochenen Fall hatte der Mieter die Wohnung nur noch als Lagermöglichkeit für seine Küche und Möbel genutzt. Eine solche Nutzung als Lagerraum ist erheblich weniger wert als die Nutzung als Wohnraum. Der BGH bestätigte daher die Auffassung der Vorinstanz, dass der Mieter dem Vermieter hierfür nur die üblichen Einlagerungskosten zu ersetzen hat – nicht die volle Monatsmiete. Außerdem hat der VIII. Zivilsenat bei der Berechnung ausdrücklich nur die tatsächlich belegte Lagerfläche (Teile der Wohnung) statt der gesamten Wohnfläche zugrunde gelegt, um den geringeren Nutzungswert zu berücksichtigen.
Zusammengefasst stärkt der BGH mit diesem Urteil die Rechte von Mietern in Kündigungssituationen und mahnt Vermieter zur Vorsicht: Ohne ein eindeutiges Rückgabeverlangen kein voller Entschädigungsanspruch. Vermieter können einen finanziellen Ausgleich dann nur im Rahmen der ungerechtfertigten Bereicherung verlangen – und auch dort nur in Höhe des tatsächlich gezogenen Vorteils.
Praktische Folgen und Handlungsempfehlungen für Mieter
1. Kündigungsklauseln prüfen: Mieter, die in ihrem Mietvertrag an eine lange Kündigungsfrist oder einen Kündigungsverzicht gebunden sind, sollten wissen, dass Klauseln über mehr als 4 Jahre Kündigungsverzicht unwirksam sein können. Im Zweifel ist eine anwaltliche Prüfung sinnvoll. Im besprochenen Fall konnte der Mieter trotz vereinbarter 5-Jahres-Bindung wirksam kündigen, weil die Klausel unwirksam war. Tipp: Lassen Sie solche Vertragsklauseln prüfen – unter Umständen können Sie früher aus dem Vertrag, als der Vermieter es wahrhaben will.
2. Kündigung unter Vorbehalt durchsetzen: Kündigt der Mieter und gerät darüber in Streit mit dem Vermieter, sollte er klar kommunizieren, dass die Kündigung nach seiner Auffassung wirksam ist. Sofern der Vermieter dies bestreitet, kann es – wie hier – sinnvoll sein, vorerst weiter die Miete zu zahlen, allerdings unter Vorbehalt der Rückforderung. Dadurch vermeiden Mieter, in Zahlungsverzug zu geraten oder eine fristlose Kündigung zu riskieren, und können im Erfolgsfall das Geld zurückfordern. Genau dies tat der Mieter im BGH-Fall für fünf Monate und hatte damit Erfolg: Er bekam die vorbehaltlich gezahlten Beträge (abzüglich einer geringen Nutzungsentschädigung) zurück.
3. Wohnungsrückgabe anbieten: Auch wenn der Vermieter die Kündigung nicht akzeptiert, sollte der Mieter nachweisbar die Rückgabe der Wohnung anbieten (z.B. schriftlich die Schlüsselübergabe anbieten). Kommt der Vermieter dem nicht nach, befindet sich der Mieter auf der sicheren Seite. Denn wie der BGH entschied, kann dem Mieter kein Vorenthalten der Mietsache vorgeworfen werden, wenn der Vermieter die Rücknahme verweigert. Dokumentieren Sie solche Angebote und Reaktionen des Vermieters, um im Streitfall Beweise zu haben.
4. Nutzungsvorteile gering halten: Solange die Wirksamkeit der Kündigung ungeklärt ist, sollten Mieter die Nutzung der Wohnung möglichst komplett einstellen, um keine unnötigen Bereicherungsansprüche zu provozieren. Im besagten Fall hatte der Mieter zwar Möbel eingelagert, was einen kleinen Wertersatz zur Folge hatte. Je weniger (und kürzer) Sie die Wohnung nach dem Kündigungsdatum noch nutzen, desto weniger müssen Sie dem Vermieter im Worst Case ersetzen. Ideal ist es, alle persönlichen Gegenstände zu entfernen und dem Vermieter den Besitz anzubieten. Dann kann allenfalls eine sehr geringe Nutzungsentschädigung anfallen – oder gar keine, wenn der Vermieter die Rücknahme verweigert.
5. Rechtzeitig rechtlichen Rat suchen: Fälle wie dieser können komplex werden und sich lange hinziehen. Mieter sollten frühzeitig rechtlichen Rat einholen, insbesondere wenn der Vermieter auf Vertragserfüllung beharrt. Oft kann eine anwaltliche Beratung helfen, die eigene Rechtsposition zu stärken, etwa durch Hinweise auf die Unwirksamkeit von Vertragsklauseln oder die richtige Vorgehensweise bei strittigen Kündigungen.
Praktische Folgen und Handlungsempfehlungen für Vermieter
1. Vertragsklauseln realistisch einschätzen: Vermieter sollten bei langfristigen Kündigungsverzichts-Klauseln vorsichtig sein. Ein formularmäßiger Kündigungsverzicht von über 4 Jahren gilt als unwirksam. Das bedeutet, dass Mieter trotz solcher Klauseln mit der gesetzlichen Frist kündigen können. Empfehlung: Nutzen Sie wenn nötig nur Kündigungsausschlüsse bis maximal 4 Jahre oder lassen Sie Individualvereinbarungen anwaltlich prüfen. Andernfalls laufen Sie Gefahr, dass der Mieter früher auszieht und Sie sich nicht darauf verlassen können, fünf Jahre lang Miete zu erhalten.
2. Im Kündigungsfall unverzüglich reagieren: Erkennt ein Mieter die Kündigungsklausel nicht an und kündigt vorzeitig, sollten Vermieter schnell und überlegt reagieren. Bleiben Sie nicht passiv. Wenn Sie der Meinung sind, das Mietverhältnis bestehe fort, kommunizieren Sie klar, dass Sie die Fortsetzung des Mietvertrags verlangen und – hilfsweise für den Fall, dass die Kündigung doch wirksam sein sollte – die sofortige Rückgabe der Wohnung fordern. Dieses Eventualverlangen mag widersprüchlich klingen, ist aber wichtig: Nur wenn Sie nachweislich die Rückgabe einfordern, kann Ihnen im Nachhinein Nutzungsentschädigung nach § 546a BGB zustehen. Andernfalls, wie der BGH betont, verlieren Sie diesen Anspruch komplett.
3. Doppelstrategie: Schadenminderung vs. Vertragsanspruch: Steht eine vorzeitige Kündigung im Raum, befinden sich Vermieter in einer schwierigen Lage. Einerseits will man an der Vertragsbindung festhalten, andererseits drohen Einnahmeausfälle. Prüfen Sie realistisch die Wirksamkeit der Kündigung (ggf. mit anwaltlicher Hilfe). Ist die Wirksamkeit unklar, sollten Vermieter proaktiv handeln, um den Schaden gering zu halten. Das könnte bedeuten, möglichst zeitnah einen neuen Mieter zu suchen oder zumindest die Wohnung zurückzunehmen und anderweitig zu verwerten. Achtung: Tun Sie dies, ohne Ihren Vertragsanspruch aufzugeben – etwa indem Sie schriftlich festhalten, dass die Annahme der Schlüssel „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht“ erfolgt. So können Sie im Worst Case (Kündigung war unwirksam) wenigstens Folgeschäden mindern und im Best Case (Kündigung war wirksam) bereits einen Nachmieter haben.
4. Kein Automatismus bei Nutzungsentschädigung: Verlassen sich Vermieter nicht blind auf § 546a BGB. Dieses Urteil zeigt, dass eine Nutzungsentschädigung keineswegs garantiert ist, wenn man die Wohnung nicht zurückerhält. Ohne Rücknahmewillen kein § 546a-Anspruch! Selbst wenn der Mieter die Wohnung nach Vertragsende noch teilweise nutzt, steht Ihnen dann allenfalls ein Bereicherungsanspruch zu. Und dieser deckt nur den objektiven Nutzungswert ab, nicht unbedingt die volle Miete. Im vorliegenden Fall entsprach der Anspruch nur den Lagerkosten für ein paar Möbelstücke – ein Bruchteil der eigentlichen Miete. Praxis-Tipp: Um nicht auf Kosten sitzen zu bleiben, sollten Vermieter spätestens ab Mietende aktiv die Rückgabe verlangen und notfalls gerichtliche Schritte (z.B. Räumungsklage oder Feststellungsklage zur Vertragsbeendigung) einleiten, anstatt abzuwarten.
5. Dokumentation und Kommunikation: Stellen Sie sicher, dass alle Schritte gut dokumentiert sind. Schriftliche Aufforderungen an den Mieter (Rückgabe der Wohnung, Zahlungsaufforderungen etc.) sind unerlässlich. Im Streitfall muss nachvollziehbar sein, dass Sie den Willen hatten, die Wohnung zurückzubekommen. Fehlt ein solider Nachweis, könnten Gerichte zugunsten des Mieters entscheiden, dass kein Vorenthalten vorlag. Ebenso sollten Reaktionen des Mieters (etwa Angebote zur Schlüsselrückgabe) nicht ignoriert werden – reagieren Sie darauf schriftlich, um Ihre Position zu verdeutlichen.
Dieses BGH-Urteil vom 18.06.2025 (Az. VIII ZR 291/23) führt zu einem Umdenken in der mietrechtlichen Praxis. Mieter in vergleichbaren Situationen können sich auf die Stärkung ihrer Rechte berufen und sollten dennoch umsichtig vorgehen. Vermieter müssen ihre Strategie bei Streit um vorzeitige Kündigungen anpassen, um nicht finanziell leer auszugehen. In jedem Fall lohnt es sich, frühzeitig juristischen Rat einzuholen und die im Urteil aufgezeigten Leitlinien zu beachten, damit beide Seiten ihre Rechte wahren und ihre Pflichten kennen. Die entscheidenden Fundstellen des Urteils – insbesondere zu § 546a BGB und § 818 Abs. 2 BGB – machen deutlich, dass Fairness und tatsächlicher Nutzen im Vordergrund stehen: Kein Vermieter soll unangemessen bereichert, aber auch kein Mieter grundlos belastet werden. Dieses ausgewogene Ergebnis sollten Mieter und Vermieter bei künftigen Auseinandersetzungen stets im Blick behalten.