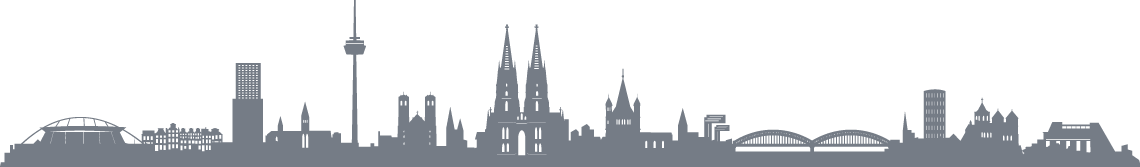Ein Bewegungsmelder-Strahler am Nachbarhaus kann nachts hell ins eigene Schlafzimmer leuchten. Doch wann muss man das hinnehmen – und wann kann man sich wehren?
Sachverhalt: Nachbarschaftsstreit um einen Bewegungsmelder-Strahler in Köln
In Köln stritten zwei Nachbarn über das Licht eines Bewegungsmelder-Strahlers, der vom Grundstück eines Mehrfamilienhauses aus in das benachbarte Einfamilienhaus leuchtete. Konkret hatte ein Mann, der zusammen mit seiner Mutter ein Haus bewohnt, den Nachbarn auf Unterlassung der Lichtemissionen verklagt. Der Bewegungsmelder am Nachbargebäude schaltete einen Außenstrahler ein, sobald er eine Bewegung registrierte – das Licht brannte dann für ca. 90 Sekunden und drang in das zum Nachbargrundstück liegende Schlafzimmer der Mutter. Dieses kurze, aber wiederkehrende Aufleuchten führte zu Unmut beim Kläger, der verlangte, dass der Nachbar den Strahler abbaut oder anders positioniert.
Sowohl das erstinstanzliche Amtsgericht Köln (AG) als auch in zweiter Instanz das Landgericht Köln (LG) wiesen die Klage jedoch ab. Die Gerichte wählten einen pragmatischen Lösungsansatz: Anstatt dem Nachbarn die Beleuchtung zu verbieten, wurde dem Kläger nahegelegt, selbst für Abhilfe zu sorgen – etwa durch das Anbringen von Rollläden, Jalousien oder Vorhängen im Schlafzimmer. Mit anderen Worten: „Bringt halt Rollos an“, lautete sinngemäß der Rat des Richters. Die Entscheidung des LG Köln vom 11.09.2025 (Az. 6 S 24/25) stellt klar, dass man das kurzzeitige Licht eines Bewegungsmelders grundsätzlich hinnehmen muss, wenn man sich als Betroffener mit einfachen Mitteln selbst davor schützen kann.
Zur Begründung führten die Gerichte aus, dass das Licht zwar in das Eigentum des Klägers eingreife und somit eine Beeinträchtigung im rechtlichen Sinne darstelle, diese Beeinträchtigung aber nicht wesentlich sei. Entscheidend sei insoweit das Empfinden eines verständigen Durchschnittsmenschen, also was einem Nachbarn unter Abwägung aller Umstände noch zumutbar ist. Der Amtsrichter hatte bei einem Ortstermin persönlich die Situation begutachtet und festgestellt, dass der Strahler weder sehr intensiv noch dauerhaft in das Schlafzimmer scheint. Die nächtliche Ruhe werde allenfalls geringfügig gestört. Außerdem – so wunderte sich der Amtsrichter – sei nicht ersichtlich, warum im Schlafzimmer der Klägerseite nicht einfach Verdunkelungseinrichtungen wie Gardinen oder Rollläden vorhanden seien. Mit geschlossenen Vorhängen ließe sich das kurze Licht schließlich problemlos abschirmen.
Das Landgericht Köln bestätigte dieses Urteil vollumfänglich. Es hob hervor, dass stets eine Einzelfallentscheidung notwendig ist, ob eine Lichtimmission unzumutbar ist. Maßgeblich ist dabei eine Interessenabwägung, in die unter anderem einfließt, inwieweit sich der betroffene Nachbar mit zumutbarem Aufwand selbst schützen kann. Im konkreten Fall befand das LG, dass dem Kläger ohne größeren Aufwand zumutbare Selbstschutz-Maßnahmen möglich sind – es gebe zahlreiche übliche Lösungen, um das Schlafzimmer zu verdunkeln. Den Einwand des Klägers, bei geschlossenen Vorhängen nicht ausreichend lüften zu können, ließ das Gericht nicht gelten: Ein gekipptes Fenster reiche zur Belüftung aus, sodass keine spürbare Beeinträchtigung der Wohnqualität entstehe. Notfalls könne man auch die Schlafzimmertür offen lassen und in einem anderen Raum lüften, so der pragmatische Hinweis des Gerichts. Die Berufung des Klägers wurde daher ohne mündliche Verhandlung einstimmig zurückgewiesen (Beschluss nach § 522 Abs. 2 ZPO).
Rechtliche Bewertung: Licht als nachbarrechtliche Immission (§ 906 BGB)
Rechtlich betrachtet fallen Lichteinflüsse vom Nachbargrundstück unter das Nachbarrecht und werden im Bürgerlichen Gesetzbuch als sogenannte Immissionen behandelt. § 906 BGB regelt, inwieweit der Eigentümer eines Grundstücks Einwirkungen vom Nachbargrundstück dulden muss. Licht ist – ebenso wie Lärm, Gerüche oder Rauch – eine (nicht stoffliche) Immission im Sinne dieser Vorschrift. Grundsätzlich gilt: Unwesentliche Beeinträchtigungen, die in einem Gebiet üblich sind, muss ein Nachbar dulden. Erst wenn die Einwirkung das gewöhnliche Maß überschreitet und die Benutzung des Grundstücks wesentlich beeinträchtigt, besteht ein Abwehranspruch (§ 906 Abs. 1 Satz 1 BGB). Ob eine Beeinträchtigung wesentlich (also unzumutbar) ist, richtet sich nach objektiven Maßstäben – insbesondere danach, was ein vernünftiger Mensch an diesem Ort als zumutbar empfindet. Private und öffentliche Interessen sind gegeneinander abzuwägen.
Im Kölner Fall wurde genau diese Abwägung vorgenommen. Das kurzzeitige Aufleuchten des Bewegungsmelder-Lichts bewerteten die Gerichte als zumutbar, weil es nur wenige Sekunden dauert und leicht zu beherrschen ist – etwa durch Vorhänge schließen. Wesentlich im Sinne des Gesetzes wäre die Störung erst, wenn sie das gewöhnliche Nutzungsempfinden deutlich übersteigt, zum Beispiel durch außergewöhnliche Helligkeit oder lange Dauer in empfindlichen Zeiten (z. B. Mitten in der Nacht). Dabei spielt auch eine Rolle, ob der Gestörte sich selbst helfen kann: Nach allgemeiner Rechtsauffassung muss der Nachbar zumutbare Schutzmaßnahmen ergreifen, um geringfügige Immissionen abzuwenden, bevor er rechtliche Schritte einleitet. Diese Pflicht zum Selbstschutz mit vertretbarem Aufwand hat das LG Köln hier betont. Mit einfachen Mitteln (Gardinen, Rollladen etc.) konnte der Kläger die Lichtwirkung abmildern – daher wurde kein Unterlassungsanspruch gegen den Nachbarn zugebilligt.
Zu unterscheiden sind solche zivilrechtlichen Nachbaransprüche nach § 906 BGB von öffentlich-rechtlichen Regeln des Immissionsschutzes. Lichtverschmutzung kann unter extremen Umständen auch als schädliche Umwelteinwirkung gelten (etwa grelle Dauerbeleuchtung oder Laser, die den Nachthimmel erhellen). In Nordrhein-Westfalen enthält das Landes-Immissionsschutzgesetz (LImschG NRW) allgemeine Verhaltensregeln zum Schutz der sogenannten Nachtruhe. Beispielsweise dürfen gewisse intensive Licht-Emissionen zwischen 22 Uhr und 6 Uhr als unzumutbare Belästigung eingestuft werden. In typischen Nachbarschaftsfällen greift jedoch in erster Linie das private Ausgleichssystem des § 906 BGB. Spezielle Vorschriften des Nachbarrechtsgesetzes NRW (Landesnachbarrechtsgesetz) regeln vor allem Abstände, Einfriedungen, Fenster- und Sichtschutzrechte zwischen Grundstücken, nicht aber immaterielle Einwirkungen wie Licht oder Geräusch. Das bedeutet: Für Streitigkeiten über störende Beleuchtung gelten im Wesentlichen die allgemeinen Regeln des BGB (§§ 1004, 906 BGB), ergänzt durch die Rechtsprechung, ohne dass das Landesrecht hierzu eigene Grenzwerte vorgibt. Wer also wegen Licht vom Nachbarn vorgehen will, beruft sich auf sein Eigentumsrecht (§ 1004 BGB in Verbindung mit § 906 BGB).
Einordnung in die Rechtsprechung zu Lichtimmissionen
Der Kölner Fall steht exemplarisch für die Abwägung zwischen Nachbarschaftsruhe und Sicherheitsbedürfnis. Bisherige Gerichtsentscheidungen zeigen ein differenziertes Bild: Maßvolle und kurzzeitige Beleuchtungen müssen oft hingenommen werden, während dauerhafte oder intensive Lichteinwirkungen eher unzulässig sein können. Bereits im Jahr 2001 entschied etwa das LG Wiesbaden, dass der dauerhafte Betrieb einer Außenleuchte (40-Watt-Glühbirne) während der Dunkelheit nicht geduldet werden muss. In jenem Fall war das Licht ständig in ein benachbartes Wohnhaus gestrahlt – eine wesentliche Beeinträchtigung der Nachtruhe. Wichtig ist: Es kann grundsätzlich nicht vom gestörten Nachbarn verlangt werden, dass er einfach seine Rollläden oder Vorhänge schließt, um der Lichtbelästigung zu entgehen. Das gilt insbesondere, wenn helles Licht ins Schlafzimmer scheint und den Schlaf stört. In solchen Konstellationen wurde Nachbarn bereits ein Unterlassungsanspruch zugesprochen, sodass der Störer die Lampe abschirmen oder ausschalten musste.
Allerdings kommt es immer auf den Einzelfall an. Die Gerichte prüfen die konkreten Umstände: Helligkeit, Dauer/Frequenz des Lichts, Uhrzeit, Ortsüblichkeit und die Zumutbarkeit von Gegenmaßnahmen. So hat z. B. das Oberlandesgericht Karlsruhe entschieden, dass starke Blendwirkungen einer auf dem Dach installierten Photovoltaik-Anlage nicht ortsüblich seien – der geblendete Nachbar konnte verlangen, dass der Eigentümer der Anlage Abhilfe schafft (etwa durch Entspiegelung oder Abschirmung). Ebenso hat das OLG Stuttgart in einem Fall übergreifender Sonnenlicht-Reflexionen durch Dachfenster geurteilt, dass extreme Blendungen unzulässig sind und der beeinträchtigte Nachbar dies nicht hinnehmen muss. Auch natürliches Licht (z. B. Sonnenreflexe oder Schattenwurf) kann also unter bestimmten Voraussetzungen eine unzumutbare Beeinträchtigung darstellen – wenngleich hier die Hürden hoch sind. Ein anderer häufiger Streitpunkt sind grelle Weihnachtsbeleuchtungen: Solange diese üblich und zeitlich begrenzt sind, müssen Nachbarn sie meistens dulden. Wird die Dekoration aber so hell oder blinkend betrieben, dass ein Schlafen in der Nacht kaum mehr möglich ist, haben Gerichte schon angeordnet, die Beleuchtung in den Nachtstunden auszuschalten (nach dem Motto: Festtagsfreude ja, aber nicht auf Kosten der Nachtruhe). Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Rechtsprechung bei Lichtimmissionen immer eine Interessenabwägung vornimmt. Maßvolle Beleuchtung zur Sicherheit oder Dekoration wird meist toleriert, doch bei erheblicher Blendwirkung oder nächtlicher Dauerbelastung stößt die Duldungspflicht an Grenzen. Der Kölner Beschluss reiht sich dahingehend ein, dass er eine eher geringfügige Beeinträchtigung als zumutbar einstuft – und dem beeinträchtigten Nachbarn zumutet, selbst einfache Vorkehrungen zu treffen, anstatt dem Verursacher strenge Auflagen zu machen.
Hinweise für betroffene Nachbarn – Rechte und Pflichten beider Seiten
Wer sich in einem ähnlichen Konflikt befindet, sollte zunächst seine Rolle in der Nachbarschaftssituation klären. Je nach Perspektive – als sogenannter Störer (Verursacher der Lichtimmission) oder als Beeinträchtigter (gestörter Nachbar) – gelten unterschiedliche Pflichten und Handlungsmöglichkeiten. Im Folgenden einige Hinweise für beide Seiten:
Tipps für den Verursacher (Nachbar mit Beleuchtungsanlage)
- Rücksicht nehmen: Als Eigentümer einer Lichtquelle auf dem Grundstück sollten Sie sich bemühen, Ihre Nachbarn nicht unnötig zu belästigen. Denken Sie an das gesetzliche Gebot der Rücksichtnahme. Installieren Sie Außenleuchten so, dass sie gezielt nur das eigene Grundstück ausleuchten und nicht direkt in fremde Fenster strahlen. Moderne Lampen haben oft verstellbare Strahler – richten Sie diese nach unten oder weg vom Nachbarhaus.
- Technik optimieren: Nutzen Sie Bewegungsmelder mit Timer und justieren Sie die Empfindlichkeit. Vermeiden Sie zu lange Leuchtdauern; 60–90 Sekunden, wie im Kölner Fall, genügen meist völlig für einen Sicherheitscheck. Achten Sie darauf, dass der Sensor nicht bei jeder Kleinigkeit (z. B. vorbeilaufende Katze) anspringt – durch richtige Platzierung und Einstellung können Fehlalarme reduziert werden. Auch die Helligkeit der Lampe sollte angemessen sein: Wählen Sie kein übermäßig grelles Flutlicht, wenn ein schwächeres Orientierungslicht ausreicht.
- Kommunikation: Informieren Sie Ihre Nachbarn, bevor Sie neue Beleuchtung installieren. Ein kurzes Gespräch kann viel Ärger verhindern. Fragen Sie nach, ob die geplante Lampe aus ihrer Sicht problematisch sein könnte. Gegebenenfalls lassen sich Kompromisse finden, z. B. zusätzliche Abschirmungen an der Lampe oder ein Bewegungsmelder statt einer Dauerbeleuchtung. Durch frühzeitigen Kontakt und Austausch können Missverständnisse vermieden werden. Oft weiß der Nachbar gar nicht, dass das Licht stört – ein Hinweis von Ihnen auf die Notwendigkeit (z.B. Einbruchschutz) und die zugesagte Rücksichtnahme (durch technische Maßnahmen) schafft Verständnis auf beiden Seiten.
- Rechtliche Vorgaben beachten: Prüfen Sie, ob lokale Vorschriften existieren. In reinen Wohngebieten und nachts von 22–6 Uhr gelten erhöhte Anforderungen an Ruhe. Extreme Lichtinstallationen (etwa Disco-Licht, Skybeamer) können in Wohngegenden gegen öffentlich-rechtliche Ordnungsvorschriften verstoßen. Im Zweifel können Sie bei der Gemeinde oder dem Ordnungsamt nachfragen, welche Regeln für Außenbeleuchtung bestehen. Als Grundsatz sollte Ihre Beleuchtung ortsüblich sein – also dem normalen Maß im Wohngebiet entsprechen.
- Bereitschaft zur Nachbesserung: Wenn ein Nachbar sich beschwert, nehmen Sie das ernst. Prüfen Sie gemeinsam vor Ort, was genau stört. Kleine Änderungen – zum Beispiel die Lampe etwas abzuschirmen oder den Bewegungsmelder anders zu justieren – können oft viel bewirken. Kommt es doch zum Streit, denken Sie daran, dass im Zweifel ein Gericht Ihre Beleuchtung als unzumutbar einstufen könnte, wenn Sie auf stur schalten. Im eigenen Interesse (und in dem eines guten Nachbarschaftsverhältnisses) ist es besser, freiwillig eine einvernehmliche Lösung zu suchen, als einen Rechtsstreit zu riskieren.
Tipps für den beeinträchtigten Nachbarn (Lichtempfänger)
- Gespräch suchen: Wenn Sie sich durch das Licht Ihres Nachbarn gestört fühlen, sprechen Sie ihn ruhig und sachlich darauf an. Oft ist dem Störer gar nicht bewusst, dass seine Beleuchtung bei Ihnen ins Schlafzimmer scheint oder blendet. Schildern Sie konkret, wann und wie das Licht Sie beeinträchtigt (z. B. „Die Lampe leuchtet genau in mein Bett und weckt mich mehrmals die Nacht.“). Bitten Sie um Abhilfe – etwa durch Ausrichten der Lampe, Kürzen der Leuchtdauer oder Anbringen eines Bewegungsmelders (falls es bisher Dauerlicht ist). Im Idealfall lässt sich in freundlichem Ton schnell eine Lösung finden, bevor Fronten sich verhärten.
- Eigenen Schutz gewährleisten: So banal es klingt – prüfen Sie zuerst Ihre eigenen Möglichkeiten, die Störung zu reduzieren. Können Sie Vorhänge, Jalousien oder Rollos benutzen, um das Licht fernzuhalten? Im Kölner Urteil wurde ausdrücklich erwartet, dass der beeinträchtigte Nachbar zumutbare Selbstschutz-Maßnahmen ergreift. Verdunkelungseinrichtungen am Fenster sind in den Nachtstunden ein einfacher und effektiver Weg, sich vor gelegentlichem Licht zu schützen. Natürlich müssen Sie nicht im Dunkeln leben, nur weil draußen eine Lampe leuchtet – aber bevor Sie zu harten Bandagen greifen, sollten Sie die naheliegenden Abwehrmaßnahmen ausschöpfen. Auch eine leichte Umstellung der Möblierung (z. B. Bett an eine andere Wand) könnte helfen, falls das Licht exakt an einer Stelle einfällt. Diese Tipps mögen selbstverständlich wirken, doch im Streit vergisst man leicht die einfachen Lösungen.
- Dokumentation: Falls die Beeinträchtigung andauert und erheblich ist, beginnen Sie, diese zu dokumentieren. Notieren Sie z. B., wann die Lichteinwirkung auftritt, wie lange sie dauert und welche Auswirkungen sie auf Sie hat (z. B. Schlafstörungen). Machen Sie eventuell Fotos oder kurze Videos, die zeigen, wie der Lichtkegel in Ihre Räume fällt. Eine solche Beweissicherung ist hilfreich, falls der Konflikt eskaliert und Sie Belege benötigen, um die Wesentlichkeit der Beeinträchtigung zu untermauern.
- Rechtslage kennen: Informieren Sie sich über Ihre rechtlichen Ansprüche. Wie oben dargestellt, steht Ihnen ein Unterlassungsanspruch (§ 1004 BGB) gegen den Nachbarn nur zu, wenn das Licht eine wesentliche Beeinträchtigung darstellt, die das übliche Maß übersteigt. Kurzzeitiges oder schwaches Licht müssen Sie eher dulden, während grelles Dauerlicht in der Nacht unzulässig sein kann. Wenn Sie unsicher sind, können Sie bei der Kommune nachhaken, ob es Richtwerte gibt (manchmal werden zur Orientierung die Technischen Anleitung Lärm herangezogen, um eine Analogie für Lichtintensität oder -häufigkeit zu haben). Auch eine Beratung durch einen Anwalt kann klären, wie Ihre Chancen stehen. Wichtig: In vielen Bundesländern – so auch in NRW – ist vor einer Klage in Nachbarstreitigkeiten obligatorisch ein Schlichtungsversuch durchzuführen. Das heißt, Sie müssen zunächst zu einer Schiedsperson oder Gütestelle, die zwischen Ihnen und dem Nachbarn zu vermitteln versucht. Ohne einen solchen Schlichtungsversuch wird die Klage vom Gericht als unzulässig abgewiesen. Diese Vorschrift soll helfen, langwierige Gerichtsverfahren zu vermeiden und eine gütliche Einigung zu fördern. Planen Sie diesen Schritt also mit ein, falls die Sache vor Gericht gehen sollte.
- Behörden einschalten (Ausnahmefall): Falls der Nachbar auf kein Gespräch reagiert und die Lichtbelästigung extrem ist (beispielsweise ein Flutlichtstrahler, der die ganze Nacht Ihren Garten taghell erleuchtet), können Sie sich zusätzlich beim Ordnungsamt erkundigen. In gravierenden Fällen, die womöglich gegen die örtlichen Ordnungsvorschriften (Nachtruhe etc.) verstoßen, kann die Behörde vermittelnd eingreifen oder den Verursacher zur Mäßigung anhalten. Dieser Weg ist eher die Ausnahme und ersetzt nicht Ihren zivilrechtlichen Anspruch, kann aber Druck ausüben, wenn alle Stricke reißen.
Praktische Handlungsempfehlungen zur Vermeidung und Lösung von Konflikten
Licht im Garten oder an der Hauswand ist ein häufiger Streitpunkt – umso wichtiger ist es, vorbeugend tätig zu werden und im Konfliktfall besonnen zu bleiben. Hier einige allgemeine Empfehlungen, um nachbarschaftliche Zwistigkeiten über Beleuchtung gar nicht erst entstehen zu lassen bzw. konstruktiv zu lösen:
- Vorher nachdenken: Planen Sie eine neue Außenbeleuchtung, versetzen Sie sich in die Lage Ihrer Nachbarn. Stellen Sie sich bei Dunkelheit an den geplanten Ort und überlegen Sie, wohin das Licht scheinen wird. Vermeiden Sie Installationen, die offensichtlich ins Nachbarhaus leuchten. Ein guter Grundsatz lautet: So viel Licht wie nötig, so wenig wie möglich. Nutzen Sie Beleuchtung zielgerichtet und sparen Sie sich überflüssige „Lichtschlachten“ – das freut übrigens nicht nur die Nachbarn, sondern spart auch Energie und schont die Umwelt.
- Frühzeitig das Gespräch suchen: Kommunikation ist der Schlüssel zu guter Nachbarschaft. Wenn man früh das Gespräch sucht, können viele Missverständnisse ausgeräumt werden. Besprechen Sie Ihre Vorhaben offen und hören Sie sich die Bedenken der anderen Seite an. In einer entspannten Unterhaltung lassen sich oft kompromissfähige Lösungen finden, mit denen alle leben können. Gleiches gilt, wenn Sie sich gestört fühlen: Melden Sie es lieber früher als später an. Je länger man schweigt und sich ärgert, desto verhärteter sind später die Fronten.
- Professionelle Vermittlung nutzen: Scheuen Sie sich nicht, bei festgefahrenen Konflikten eine neutrale Schlichtung in Anspruch zu nehmen. In NRW gibt es ehrenamtliche Schiedspersonen und anerkannte Gütestellen, die auf Nachbarschaftsstreitigkeiten spezialisiert sind. Eine moderierte Aussprache unter Leitung eines Schlichters kann helfen, Emotionen abzubauen und sachliche Lösungen (wie z.B. zeitliche Begrenzungen der Beleuchtung oder bauliche Abschirmungen) zu finden – ohne dass gleich Anwälte und Gerichte eingeschaltet werden müssen. Oft lassen sich so zukünftige Beziehungen retten, denn ein Vergleich vor einer Schiedsstelle erfolgt einvernehmlich und zukunftsorientiert, statt in Sieger-Verlierer-Manier. Beachten Sie: In vielen Fällen ist ein Schlichtungsversuch nicht nur ratsam, sondern rechtlich verpflichtend, bevor man klagen darf.
- Im Zweifel fachliche Hilfe suchen: Sollte eine Einigung partout nicht gelingen und die Beeinträchtigung erheblich bleiben, ziehen Sie fachkundige Hilfe hinzu. Ein Rechtsanwalt kann Ihre Rechtsposition einschätzen und – falls nötig – eine Unterlassungsklage vorbereiten. Mitunter kann auch ein technisches Gutachten sinnvoll sein (z.B. Messung der Beleuchtungsstärke oder der Häufigkeit der Lichtimpulse), um vor Gericht zu untermauern, dass die Immission untragbar ist. Gleichzeitig sollte der Gang vor Gericht wirklich der letzte Schritt sein. Bedenken Sie, dass Gerichtsverfahren Zeit, Geld und Nerven kosten – und das Nachbarschaftsverhältnis meist dauerhaft belasten. Eine einvernehmliche Lösung, bei der beide Seiten etwas nachgeben, ist in der Regel der bessere Weg.
Licht im Garten kann Sicherheit und Atmosphäre spenden, darf aber nicht zur nächtlichen Dauerbelästigung für den Nachbarn werden. Die Rechtslage verlangt hier Augenmaß von beiden Seiten. Geringfügiges oder ortsübliches Licht muss man tolerieren – und im Zweifel durch eigene Vorhänge oder Jalousien abmildern. Überzogenes Dauergeflimmer hingegen muss niemand schlaflos ertragen – dann kann der Störer rechtlich zur Räson gebracht werden. Am besten ist es jedoch, es gar nicht so weit kommen zu lassen: durch rücksichtsvolle Planung, offene Kommunikation und Kompromissbereitschaft. Dann heißt es am Ende vielleicht tatsächlich: gute Nacht – und zwar für alle Nachbarn gleichermaßen.