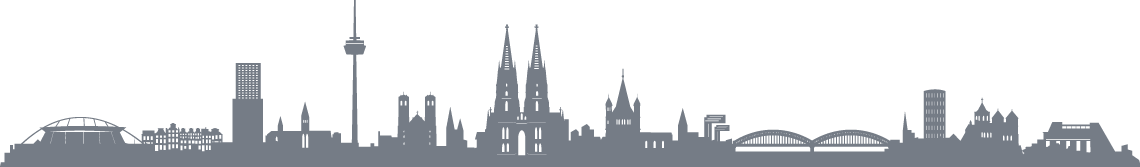Worum geht es? Ein aktueller Rechtsstreit beim Bundesgerichtshof (BGH) sorgt für Aufsehen: Darf ein Mieter durch Untervermietung seiner Wohnung finanziellen Gewinn erzielen? In dem Fall (Az.: VIII ZR 228/23) vermietete ein Hauptmieter seine Berliner Zweizimmerwohnung an Untermieter weiter – für mehr als das Doppelte der Miete, die er selbst zahlt. Die Vermieterin kündigte daraufhin den Mietvertrag. Der BGH verhandelt nun, ob diese Kündigung rechtens war und ob gewinnorientierte Untervermietung generell zulässig ist. Dieser Rechtstipp beleuchtet die Hintergründe des Falls, die rechtlichen Rahmenbedingungen und gibt praktische Hinweise für Mieter und Vermieter.
Hintergrund: Untervermietung und Erlaubnis im Mietrecht
Untermietvertrag und Zustimmung: Grundsätzlich dürfen Mieter ihre Wohnung nur mit Erlaubnis des Vermieters untervermieten. Das ergibt sich aus den mietrechtlichen Vorschriften (§§ 540, 553 BGB) und dem Mietvertrag. Ohne Zustimmung des Vermieters einen Dritten in die Wohnung aufzunehmen, gilt als vertragswidrig und kann eine Kündigung nach sich ziehen. Im beschriebenen Fall hatte der Mieter tatsächlich die Erlaubnis der Vermieterin eingeholt – jedoch befristet bis Ende Januar 2020. Als er länger im Ausland blieb und die Untervermietung eigenmächtig fortsetzte, überschritt er diese Erlaubnis.
Teilweise vs. vollständige Untervermietung: Ein Mieter hat nach deutschem Recht nur einen Anspruch darauf, einen Teil der Wohnung unterzuvermieten, wenn er hierfür ein berechtigtes Interesse hat (§ 553 Abs.1 BGB). Klassische Beispiele für ein berechtigtes Interesse sind etwa finanzielle Engpässe (z.B. Arbeitsplatzverlust) oder persönliche Veränderungen (z.B. Auszug eines Partners), die es dem Mieter erschweren, die volle Miete alleine zu tragen. Keinen gesetzlichen Anspruch gibt es hingegen auf die Untervermietung der gesamten Wohnung, etwa bei längerer Abwesenheit (z.B. Auslandsaufenthalt). In solchen Fällen darf der Vermieter frei entscheiden, ob er die Untervermietung der ganzen Wohnung erlaubt. Im vorliegenden Fall ging der Mieter für längere Zeit ins Ausland und wollte die gesamte Wohnung untervermieten. Hier war er also auf das Entgegenkommen der Vermieterin angewiesen, die die Untervermietung zunächst befristet duldete.
Vorgaben bei Untervermietung: Selbst wenn der Vermieter grundsätzlich zur Erlaubnis verpflichtet ist (z.B. bei berechtigtem Interesse für Teiluntervermietung), kann er Bedingungen stellen. So darf der Vermieter Auskunft über den Untermieter (Identität, Beruf, Dauer des Einzugs) verlangen. Außerdem kann er nach § 553 Abs.2 BGB eine angemessene Mieterhöhung fordern, falls ihm die Untervermietung sonst nicht zumutbar wäre. In der Praxis wird ein solcher Untermietzuschlag etwa verlangt, wenn durch den zusätzlichen Bewohner höhere Betriebskosten oder Abnutzung entstehen. Keinesfalls berechtigt ist der Vermieter jedoch, pauschal einen großen Anteil der Untermiete zu verlangen – die Erhöhung muss angemessen und begründbar sein. Umgekehrt gilt: Untervermietet der Mieter ohne erforderliche Erlaubnis, kann der Vermieter abmahnen und im Wiederholungsfall oder bei schwerwiegendem Verstoß sogar fristlos kündigen.
Der Fall: Gewinn durch Untervermietung in Berlin
In dem BGH-Verfahren geht es um folgenden Sachverhalt: Ein Mieter bewohnt seit 2009 eine Wohnung in Berlin, ursprünglich zu einer Nettokaltmiete von 460 € (später knapp 500 €). Wegen eines Auslandsaufenthalts bat er die Vermieterin um Untervermietungserlaubnis, um die Wohnung während seiner Abwesenheit behalten zu können. Die Erlaubnis wurde erteilt, jedoch befristet bis Januar 2020. Der Mieter blieb dann länger im Ausland als geplant und vermietete die Wohnung ohne erneute Genehmigung weiter unter. Dabei verlangte er von den Untermietern eine Untermiete von 962 € (kalt) – also deutlich mehr als das Doppelte seiner eigenen Miete. In Berlin gilt eine Mietpreisbremse für Neuvermietungen, sodass bei einer Weitervermietung dieser Wohnung maximal ca. 748 € zulässig gewesen wären. Der Untermietpreis lag somit rund 214 € über der nach Mietpreisrecht erlaubten Grenze.
Die Vermieterin erfuhr schließlich von der fortgesetzten Untervermietung (eine neue Hausverwaltung entdeckte die Untermieter in der Wohnung). Sie fühlte sich getäuscht und kündigte dem Hauptmieter ordentlich wegen unberechtigter Untervermietung und Gewinnerzielungsabsicht. Anschließend erhob sie Räumungsklage gegen den Hauptmieter und die Untermieter. Vor dem Amtsgericht Berlin-Charlottenburg hatte die Vermieterin zunächst keinen Erfolg – die Räumungsklage wurde abgewiesen. Das Landgericht Berlin jedoch gab der Vermieterin in zweiter Instanz Recht: Der Mieter wurde zur Räumung verurteilt, die Kündigung wurde als wirksam erachtet. Damit landete der Fall schließlich beim BGH, da der Mieter Revision einlegte.
Streitpunkt: Darf ein Mieter an der Untervermietung verdienen?
Der zentrale rechtliche Streitpunkt ist, ob der Vermieter es dulden muss, dass der Hauptmieter durch Untervermietung einen wirtschaftlichen Gewinn erzielt. Nach bisheriger Auffassung des Landgerichts Berlin und anderer Gerichte ist die Untervermietung primär dazu gedacht, dem Mieter eine Kostenersparnis zu ermöglichen – nicht jedoch dazu, ein Geschäftsmodell zu betreiben. Sinn und Zweck der Untervermietung ist es also, dem Hauptmieter das Halten der Wohnung in schwierigen Zeiten zu ermöglichen (z.B. während Auslandsaufenthalt, vorübergehender finanzieller Engpass), indem ein Teil der Kosten gedeckt wird. Gewinnerzielung darüber hinaus widerspricht diesem Zweck nach vorläufiger Einschätzung auch aus Sicht des BGH: Der Vorsitzende Richter Ralph Bünger betonte in der Verhandlung, die Untervermietung solle den Mieter entlasten und seine Kosten verringern, nicht ihm Gewinne verschaffen. Er verwies sogar auf das historische Reichsmietgesetz von 1922, das bereits ein „angemessenes Verhältnis“ zwischen Hauptmiete und Untermiete forderte.
Position des Vermieters: Die Vermieterin (bzw. ihr Anwalt) argumentiert entsprechend, dass das Bestandsschutzinteresse des Mieters zwar respektiert wird – man ihm also helfen darf, die Miete weiterzahlen zu können – „aber nur so weit“. Es gehe nicht an, dass der Mieter aus der Wohnung einen Profit schlägt, während der Vermieter leer ausgeht. Im konkreten Fall empfand die Vermieterin den Aufpreis von rund 500 € monatlich als unverhältnismäßig hoch, zumal sie an diesen Erträgen nicht beteiligt wurde. Auch der Verstoß gegen die Mietpreisbremse wurde angeführt: Eine Untermiete weit über der ortsüblichen Vergleichsmiete brauche kein Vermieter zu erlauben. Diese Sichtweise stärkt die Eigentümerrechte und deckt sich mit früheren Entscheidungen: So hat etwa bereits 2019 das LG Berlin entschieden, dass ein Vermieter die Untervermietung einer 1-Zimmer-Wohnung zwecks Auslandsreise nicht genehmigen muss, wenn der Mieter dabei über 50 % Gewinn gemacht hätte – der Vermieter forderte damals einen Anteil am Untermieterlös und durfte mangels Einigung die Erlaubnis verweigern.
Position des Mieters: Der Hauptmieter verteidigt sich damit, dass er vor allem sein berechtigtes Interesse verfolgte, die Wohnung während der Abwesenheit zu erhalten, und nicht primär Gewinnabsichten hatte. Seine Anwältin führte aus, der Mieter habe ein ganzes „Motivbündel“ gehabt – natürlich habe der Untermietzins auch die Kosten für die Vollmöblierung und Ausstattung der Wohnung widerspiegeln sollen, aber in erster Linie wollte er die Wohnung nicht verlieren. Zudem habe der Mieter persönliche Gegenstände in der Wohnung gelassen und einen Schlüssel behalten, um seinen Mitgewahrsam nicht aufzugeben. Aus Sicht des Mieters geht das Untermietverhältnis die Vermieterin insofern „nichts an“, als es sich um eine Abrede zwischen ihm und den Untermietern handelt. Die Untermieter hätten dem höheren Mietpreis freiwillig zugestimmt – und im Übrigen würde eine Beendigung des Hauptmietverhältnisses vor allem die Untermieter hart treffen, die dann ihre Unterkunft verlieren. Kurz gesagt: Der Mieter pocht auf Vertragsfreiheit gegenüber seinen Untermietern und darauf, dass sein Handeln im Rahmen des Zulässigen war, da er die Wohnung ja nicht dauerhaft entzogen, sondern nur untervermittelt habe.
Rechtliche Bewertung und Tendenz des BGH
Die bislang einzige höchstrichterliche Leitlinie dazu fehlt – genau deshalb sieht der BGH hier grundlegenden Klärungsbedarf. In der mündlichen Verhandlung am 24.09.2025 ließ der VIII. Zivilsenat jedoch bereits durchblicken, dass er der Linie des Landgerichts folgen könnte: Gewinnbringende Untervermietung wird vom BGH äußerst skeptisch gesehen. Vorsitzender Richter Bünger bezeichnete die Frage, ob und wann man mit Untervermietung Gewinne machen darf, als „hochinteressant“ und für Vermieter, Mieter und Untermieter gleichermaßen bedeutsam. Er stellte klar, dass bisher „höchstrichterlich nicht geklärt“ ist, unter welchen Voraussetzungen finanzielle Gewinne bei Untervermietung zulässig sein könnten. Die Tendenz ließ sich aber aus seinen Hinweisen entnehmen: Untervermietung soll der Kostenersparnis dienen, nicht der Gewinnerzielung.
Bemerkenswert ist, dass Bünger auf frühere Urteile des BGH verwies, wonach eine Untervermietung den Mieter finanziell entlasten und seine Kosten senken solle. All dies deutet darauf hin, dass der BGH geneigt ist zu entscheiden, dass ein Mieter keinen Anspruch auf Untervermietung zu deutlich höheren Preisen hat, zumindest nicht ohne die Vermieterin daran zu beteiligen. Sollte der BGH dieser Einschätzung folgen, wäre die Kündigung der Vermieterin rechtens und der Mieter müsste die Wohnung räumen. Eine endgültige Entscheidung ist allerdings noch offen – das Gericht hat eine intensive Beratung angekündigt und will das Urteil am 28. Januar verkünden.
Mietpreisbremse und Möblierungszuschläge: Im vorliegenden Fall kam erschwerend hinzu, dass der verlangte Untermietzins gegen die Mietpreisbremse verstieß. Wichtig zu wissen: Wer untervermietet, tritt rechtlich selbst in die Vermieterrolle gegenüber dem Untermieter – und muss sich an dieselben Regeln halten. Insbesondere gilt auch hier die Begrenzung, dass die Miete höchstens 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf (sofern die Mietpreisbremse in der Region greift). Ein Hauptmieter darf also nicht einfach einen weit höheren Preis aufrufen, als für reguläre Neuvermietungen zulässig wäre. Zwar kann für Möblierung ein Aufschlag verlangt werden, denn eine voll ausgestattete Wohnung hat einen Mehrwert. Doch gibt es bislang weder klare gesetzliche Vorgaben zur Höhe solcher Möblierungszuschläge, noch die Regel, dass eine Untermiete generell nicht höher sein dürfe als die Hauptmiete. Diese Lücke nutzen manche Untervermieter, um die Mietpreisbremse zu umgehen. Im geschilderten Fall argumentierte der Mieter genau damit: Er habe die Wohnung „mit allem Drum und Dran“ überlassen und den Wert seines Hausrats eingepreist. Allerdings fehlt es an objektiven Berechnungsmodellen, wie Möbel und Ausstattung auf die Miete umzulegen sind, wie auch der Deutsche Mieterbund bestätigt. Die Politik hat das Problem erkannt – laut Mieterbund arbeitet das Bundesjustizministerium an einem Gesetzentwurf, um Möblierungszuschläge klar zu regeln und deren zulässige Höhe festzulegen. Bis dahin gilt: Ein Möblierungszuschlag muss angemessen sein. Wer exorbitant hohe Preise mit Verweis auf Einrichtung verlangt, riskiert, dass dies als Umgehung der Mietpreisbremse oder als unzulässige Gewinnerzielung bewertet wird.
Interessen der Untermieter: Bei der ganzen Diskussion darf man die Untermieter nicht vergessen. Sie sind in angespannten Wohnungsmärkten oft gezwungen, solche Angebote anzunehmen, weil sie keine reguläre Wohnung finden. Der Deutsche Mieterbund kritisiert, dass Modelle der „gewinnbringenden Untervermietung“ die Notlage suchender Mieter ausnutzen. Ein Untermieter zahlt im Grunde einen Aufpreis für nichts – der Hauptmieter leistet ja keine zusätzliche Gegenleistung außer der Wohnungsüberlassung, die er selbst günstiger erhält. Das kann zu Recht als sozial ungerecht empfunden werden. Entsprechend empathisch werden Gerichte die Interessen der Untermieter berücksichtigen. Im BGH-Fall wurde z.B. erwähnt, dass die Untermieter – ohnehin oft die Schwächsten auf dem Wohnungsmarkt – im Kündigungsfall sofort ihre Bleibe verlieren würden. Allerdings ist zu beachten, dass die Untermieter hier formal keine Vertragsbeziehung zur Vermieterin haben; ihr Schicksal hängt am Hauptmieter. Rechtlich dürfte das Gericht primär die Frage der Pflicht des Vermieters zur Erlaubniserteilung bzw. das Kündigungsrecht beurteilen. Dennoch fließt in die Abwägung ein, ob das Verhalten des Hauptmieters schutzwürdig ist – das Ausnutzen verzweifelter Wohnungssuchender durch überhöhte Untermiete könnte aus Sicht des Gerichts ein starkes Argument gegen die Zumutbarkeit der Untervermietung sein.
Praxistipps für Mieter bei Untervermietung
Überlegtes Vorgehen für Hauptmieter: Wer als Mieter seine Wohnung untervermieten möchte, sollte einige Punkte beachten, um nicht in rechtliche Fallen zu tappen. Hier sind praktische Tipps aus Mietersicht:
- Immer Vermieter um Erlaubnis fragen: Eine schriftliche Erlaubnis des Vermieters zur Untervermietung ist Pflicht (es sei denn, es handelt sich nur um kurzfristigen Besuch ohne Bezahlung). Legen Sie dem Vermieter dar, warum Sie untervermieten möchten (berechtigtes Interesse) und für welchen Zeitraum. Ohne Genehmigung riskieren Sie eine Kündigung.
- Ehrlich über Untermietzins informieren: Seien Sie transparent, wie viel Untermiete Sie nehmen wollen. Verlangen Sie nur so viel, dass Ihre eigenen Wohnkosten gedeckt sind, ggf. plus einem angemessenen Aufschlag für Möblierung oder Nebenkosten. Sobald Sie deutlich mehr nehmen, bewegen Sie sich in einer Grauzone – der Vermieter muss das nicht akzeptieren. Außerdem könnten Untermieter später Rückforderungen stellen, wenn die Mietpreisbremse überschritten wurde.
- Mietpreisbremse beachten: Recherchieren Sie die ortsübliche Vergleichsmiete für Ihre Wohnung (z.B. Mietspiegel) und kalkulieren Sie, ob die verlangte Untermiete maximal 10 % darüberliegt, falls die Mietpreisbremse anwendbar ist. Als Untervermieter gelten Sie rechtlich wie ein Vermieter und sollten die Preisgrenzen einhalten, um keine Rechtsverstöße zu begehen.
- Möblierungszuschlag realistisch ansetzen: Wenn Sie eine voll möblierte Wohnung untervermieten, dürfen Sie zwar etwas mehr verlangen, aber der Zuschlag muss angemessen Orientieren Sie sich an groben Richtwerten oder Transparenz (z.B. wie viel Miete werden für vergleichbar möblierte Wohnungen verlangt?). Überzogene Zuschläge wirken wie eine Umgehung der Mietpreisbremse und könnten im Streitfall nicht standhalten.
- Befristung und Verlängerung klären: Halten Sie sich an die genehmigte Dauer der Untervermietung. Wenn Sie länger abwesend sind als geplant, informieren Sie rechtzeitig den Vermieter und bitten um Verlängerung der Erlaubnis. Schweigt der Vermieter, bedeutet das nicht automatisch Zustimmung – holen Sie im Zweifel rechtlichen Rat ein, statt einfach weiter zu vermieten.
- Vertragliche Regelungen einhalten: Schließen Sie einen klaren Untermietvertrag mit den Untermietern. Regeln Sie darin Mietpreis, Kaution, Möblierungslisten, Hausordnung, Dauer etc. Achten Sie darauf, nichts zu vereinbaren, was Ihr eigener Hauptmietvertrag verbietet. Der Hauptmieter bleibt gegenüber dem Vermieter voll verantwortlich – etwa für Schäden oder Verstöße der Untermieter.
- Kein gewerbliches Airbnb aus der Wohnung machen: Denken Sie daran, dass Ihre Wohnung kein gewerbliches Objekt ist. Kurzzeitvermietungen an Touristen (Airbnb etc.) sind in vielen Städten genehmigungspflichtig oder verboten. Auch eine regelmäßige Untervermietung mit Gewinnerzielung könnte als unerlaubte Nutzung eingestuft werden. Nutzen Sie die Untervermietung wirklich nur zur Überbrückung von Abwesenheiten oder zur Kostenteilung, nicht als dauerhafte Einnahmequelle.
Praxistipps für Vermieter bei Untermieterlaubnis
Auch für Vermieter ist das Thema Untervermietung sensibel. Einerseits sollen berechtigte Interessen des Mieters berücksichtigt werden, andererseits möchte man Missbrauch und Geschäftsmodelle im eigenen Wohnraum verhindern. Hier einige Hinweise aus Vermietersicht:
- Berechtigtes Interesse prüfen: Verweigern Sie eine Untervermietung nicht vorschnell, wenn der Mieter ein berechtigtes Interesse vorträgt (z.B. Auslandssemester, finanzielle Engpässe). Die Rechtslage verpflichtet zur Erlaubnis bei Teiluntervermietung, sofern kein wichtiger Ablehnungsgrund vorliegt (§ 553 BGB). Andernfalls riskieren Sie Schadenersatzansprüche des Mieters. Prüfen Sie aber genau, wer Untermieter werden soll und ob dies zum Objekt passt (keine Überbelegung, keine gewerbliche Nutzung etc.).
- Schriftliche Vereinbarung treffen: Erteilen Sie die Erlaubnis immer schriftlich und befristen Sie sie gegebenenfalls. Sie können festhalten, für welchen Zeitraum und für welche Person(en) die Untervermietung gilt. Legen Sie ggf. auch einen Untermietzuschlag fest, sofern sachlich gerechtfertigt (etwa bei höherer Nebenkostenbelastung). Eine klare Vereinbarung schützt beide Seiten vor Missverständnissen.
- Angemessenen Mietanteil verlangen: Wenn Ihr Mieter Gewinn aus der Untervermietung schlägt, müssen Sie das nicht kommentarlos hinnehmen. Zwar besteht kein Freibrief, beliebige Aufschläge zu fordern, aber Sie können im Rahmen des § 553 Abs.2 BGB eine Mieterhöhung verlangen, falls die Untervermietung für Sie Nachteile oder erhöhten Aufwand bringt. Beispiel: zusätzliche Person = höherer Wasserverbrauch, Abnutzung etc. – dafür kann ein kleiner monatlicher Zuschlag angemessen sein. Ein solcher Zuschlag verhindert indirekt, dass der Hauptmieter alleine den Profit einstreicht.
- Kontrolle und Information: Bleiben Sie wachsam, was in Ihrer Wohnung passiert. Wenn Sie Hinweise haben, dass unerlaubt untervermietet wird oder der Mieter deutlich mehr verlangt, gehen Sie der Sache nach. Sie haben ein Recht auf Auskunft, ob und an wen untervermietet wurde, insbesondere wenn der Mieter nach Erlaubnis gefragt hat. Bei Verstößen sollten Sie zunächst abmahnen und zur Unterlassung auffordern.
- Rechtzeitig reagieren: Sollte ein Mieter die Untervermietung über den erlaubten Zeitraum hinaus fortführen oder Bedingungen überschreiten, zögern Sie nicht, konsequent zu handeln. Sie können die Erlaubnis widerrufen (falls vertraglich oder gesetzlich vorgesehen, z.B. bei Missbrauch) und im Extremfall eine Kündigung Im vorliegenden Fall hat die Vermieterin genau dies getan, als sie von der fortgesetzten und gewinnorientierten Untervermietung erfuhr.
- Im Zweifel rechtlichen Rat einholen: Die Rechtslage bei Untervermietung kann komplex sein – insbesondere mit Blick auf lokale Mietpreisbegrenzungen und die Abgrenzung von erlaubter Kostendeckung vs. unzulässigem Gewinn. Holen Sie im Zweifel anwaltlichen Rat ein, bevor Sie eine Erlaubnis verweigern oder eine Kündigung aussprechen. Jeder Fall ist anders gelagert, und eine falsche Reaktion könnte teuer werden (etwa wenn die Kündigung unwirksam wäre oder Sie unberechtigt eine Untervermietung blockieren).
Ausblick
Der Fall „gewinnbringende Untervermietung“ vor dem BGH macht deutlich, dass das deutsche Mietrecht hier an einer wegweisenden Klärung steht. Bisher stärken die Gerichte tendenziell die Position der Vermieter, indem sie klarstellen, dass Untervermietung der Kostenentlastung dient und nicht zur Einnahmequelle des Mieters werden darf. Mieter sollten daher sehr vorsichtig sein, in welchem Umfang sie Mehrerlöse durch Untermieter generieren – was über eine moderate Kostendeckung hinausgeht, könnte unzulässig sein. Vermieter wiederum sind gut beraten, Untervermietungsanfragen wohlwollend, aber wachsam zu behandeln: Berechtigte Interessen ermöglichen, aber bei Anzeichen von Missbrauch einschreiten.
Mit dem anstehenden BGH-Urteil (voraussichtlich am 28. Januar) erhoffen sich alle Seiten klare Leitlinien. Möglich ist, dass der BGH festschreibt, dass Gewinne aus Untervermietung unzulässig sind – oder Kriterien definiert, unter denen ein gewisser Aufschlag doch gerechtfertigt sein kann (z.B. bei Möbelüberlassung in bestimmtem Rahmen). Unabhängig vom Urteil zeichnet sich bereits ab, dass Untervermieter sich an vergleichbare Regeln wie reguläre Vermieter halten müssen, insbesondere was Mietpreisbegrenzungen angeht. Wer als Hauptmieter also auf Zeit zum Untervermieter wird, sollte die Vermieter-Brille aufsetzen und sich fragen: Wäre dieser Untermietpreis auch zulässig, wenn ich der Eigentümer wäre? – Ist die ehrliche Antwort Nein, sollte man den Preis nach unten korrigieren.
Abschließend bleibt festzuhalten: Profit statt Kostenersparnis – dieses Motto verträgt sich schlecht mit dem sozialen Mietrecht in Deutschland. Die Wohnungsnot darf nicht durch private Weitervermietung zu Wucherpreisen verschärft werden. Mieter, die fair und abgesprochen untervermieten, haben nichts zu befürchten. Doch wer es „übertreibt“ und seine Bude für mehr als das Doppelte der eigenen Miete weiterreicht, riskiert den Verlust der Wohnung Die besten Tipps für beide Seiten lauten daher: Kommunikation, Fairness und die Grenzen des Erlaubten respektieren. Dann kann Untervermietung – im Sinne aller Beteiligten – ein sinnvolles Instrument sein, ohne zum Streitfall zu werden.