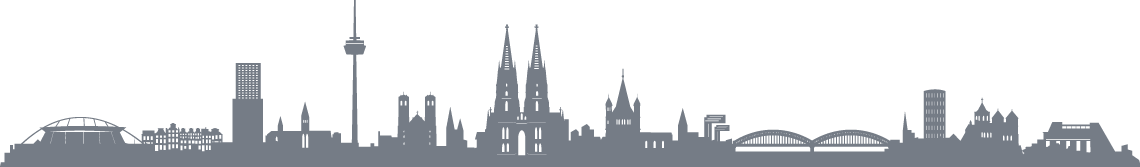Starkregen und Überflutungen können erhebliche Schäden an Häusern verursachen. Doch wann gilt Wasser auf dem Grundstück eigentlich als versicherte Überschwemmung im Sinne der Wohngebäudeversicherung? Ein aktuelles Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Dresden vom 17.06.2025 liefert hierzu wichtige Hinweise. Im folgenden Rechtstipp fassen wir die Entscheidung allgemeinverständlich zusammen und geben Grundstückseigentümern konkrete Empfehlungen – sowohl zum richtigen Versicherungsschutz als auch zu baulichen Vorsorgemaßnahmen.
OLG Dresden: 5 cm Wasser auf der Terrasse sind keine Überschwemmung
In dem vom OLG Dresden entschiedenen Fall hatte heftiger Regen dazu geführt, dass sich auf der Terrassenfläche einer Hausbesitzerin das Wasser etwa bis zu 5 cm hoch staute. Die Eigentümerin meldete den Schaden ihrer Wohngebäudeversicherung (mit Elementarschaden-Deckung) – doch der Versicherer verweigerte die Zahlung, und letztlich bekam der Versicherer vor Gericht Recht.
Der Knackpunkt: Nach den Versicherungsbedingungen liegt eine versicherte Überschwemmung nur vor, wenn der „Grund und Boden“ des Versicherungsgrundstücks von erheblichen Mengen Oberflächenwasser überflutet wird. Im Prozess war umstritten, ob die gepflasterte Terrasse überhaupt zum „Grund und Boden“ zählt – das Landgericht verneinte dies, das OLG hielt die Frage für zweifelhaft und letztlich offengelassen. Entscheidend war nämlich ein anderer Punkt: Es konnte nicht bewiesen werden, dass sich erhebliche Wassermassen auf der Terrasse angesammelt hatten. Bloß ein bisschen stehendes Wasser – selbst ein paar Zentimeter hoch – reichte nach Auffassung des Gerichts nicht aus, um als Überschwemmung im Sinne der Versicherung zu gelten. Mit anderen Worten: Eine Pfütze oder ein Wasserfilm von 5 cm Höhe ist kein versicherter Überschwemmungsschaden.
Diese Entscheidung steht im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung. Bereits der Bundesgerichtshof (BGH) hat klargestellt, dass eine Überschwemmung nur bei einer Ansammlung erheblicher Wassermengen auf der Geländeoberfläche vorliegt. Auch muss nicht das gesamte Grundstück unter Wasser stehen – aber es genügt eben nicht, wenn lediglich ein sehr kleiner Bereich am Haus überschwemmt ist. Faustregeln aus der Fachliteratur sprechen davon, dass bei einem gewöhnlichen Grundstück zumindest um die 10% der unbebauten Fläche überflutet sein sollten, damit von einer Überschwemmung gesprochen werden kann. In jedem Fall muss das Wasser so großflächig oder hoch vorhanden sein, dass es nicht mehr geordnet abfließen oder versickern kann. Kleiner Tipp: Machen Sie zur Beweissicherung Fotos und Messungen, wenn Ihr Grundstück nach Starkregen unter Wasser steht. Im Streitfall muss der Versicherungsnehmer nämlich nachweisen, dass tatsächlich eine Überschwemmung vorlag – und wie das OLG betonte, müssen die Indizien diesem Nachweis mit genügender Sicherheit standhalten.
Was zählt als „Grund und Boden“? – Unklare Fälle bei Terrasse, Lichtschacht & Co.
Viele Hauseigentümer fragen sich, ob Bereiche wie Terrassen, gepflasterte Einfahrten, Kellerlichtschächte oder Außentreppen bei Überschwemmungsschäden mitversichert sind. Nach dem üblichen Verständnis in Versicherungsbedingungen bezieht sich der Überschwemmungsschutz auf den Boden des Grundstücks, nicht auf das Gebäude selbst. Normalerweise bedeutet „Überschwemmung“, dass ansonsten trockenes Erdreich oder Gelände vom Wasser bedeckt wird. Dementsprechend hat z.B. das OLG Frankfurt entschieden, dass Wasser in einem Lichtschacht oder an einer Kelleraußentreppe keine Überschwemmung des Grund und Bodens darstellt – denn solche Bauteile gehören zum Gebäude, nicht zur offenen Grundstücksfläche.
Ähnlich war im Dresdner Fall zweifelhaft, ob die unmittelbar ans Haus grenzende, versiegelte Terrasse noch als „Grund und Boden“ gilt. Die Rechtslage ist hier nicht abschließend geklärt – manche Gerichte verneinen den Überschwemmungsbegriff bei überfluteten Terrassen, andere Stimmen in der Literatur bejahen ihn. Das OLG Dresden hat die Frage offen gelassen. Wichtig für Grundstückseigentümer: Viele Versicherer bestehen bislang darauf, dass eine Überschwemmung grundsätzlich nur dann vorliegt, wenn der natürliche Boden überschwemmt ist. Regenwasser, das sich nur auf einem Flachdach, Balkon oder einer betonierten Fläche staut, wird oft nicht als versicherter Überschwemmungsschaden anerkannt. Wer also ein Haus mit großen versiegelten Flächen oder Spezialbereichen (Dachterrasse, Tiefgaragenabfahrt, o. ä.) hat, sollte dieses Risiko im Blick behalten.
Die gute Nachricht: Es gibt inzwischen Versicherungen, die auf die strenge „Grund und Boden“-Klausel verzichten. So bieten einige Tarife an, dass auch Wasserschäden durch starken Regen auf Terrassen, Dächern oder Hofflächen mitgedeckt sind – selbst wenn kein umliegendes Gelände überflutet wurde. Ein Vergleich und gegebenenfalls Wechsel des Versicherers kann sich in solchen Fällen lohnen, um passgenauen Schutz zu erhalten.
Praktische Tipps: Versicherungsschutz und bauliche Vorsorge
Angesichts der strengen Voraussetzungen für Überschwemmungsschäden sollten Grundstückseigentümer aktiv werden. Hier einige Handlungsempfehlungen, um böse Überraschungen zu vermeiden:
- Elementarschäden in den Vertrag einschließen: Prüfen Sie zunächst, ob Ihre Wohngebäude- (und Hausrat-)Versicherung überhaupt Überschwemmung durch Starkregen mit abdeckt. Standardmäßig sind solche Naturgefahren nämlich nur versichert, wenn eine Elementarschadenversicherung ausdrücklich vereinbart wurde. Ältere Policen haben Überschwemmung oft nur als Zusatzbaustein; neuere Verträge nach 2010 enthalten sie teilweise automatisch. Fehlt dieser Schutz, sollten Sie ihn unbedingt nachträglich einschließen – andernfalls bleibt Ihr Haus bei Starkregen-Schäden ungeschützt.
- Versicherungsbedingungen genau kennen: Falls Elementarschutz vorhanden ist, lesen Sie die Klauseln zur Überschwemmung aufmerksam. Achten Sie darauf, wie Überschwemmung definiert ist und ob es Ausschlüsse gibt. Begrifflich bedeutet Überschwemmung fast immer „Überflutung des Grund und Bodens mit erheblichen Wassermengen“. Seien Sie also darauf gefasst, dass kleinflächige oder niedrigpegelige Wasservorkommnisse nicht abgedeckt sind. Dokumentieren Sie im Schadenfall möglichst die Ausdehnung der Überflutung (Fotos, betroffene Flächen, cm-Angaben), um den Nachweis führen zu können. Wenn Ihr Grundstück viele befestigte Bereiche hat (z.B. Terrasse, Hof), fragen Sie bei Ihrem Versicherer nach, ob diese als „Grund und Boden“ gelten. Im Zweifel kann ein Tarifwechsel sinnvoll sein – einige Versicherer leisten auch bei Wasseransammlungen auf versiegelten Flächen oder Dächern, ohne auf der Boden-Überflutung zu bestehen.
- Schutz vor Rückstau vereinbaren und installieren: Neben Überschwemmung durch außen anflutendes Wasser sind Rückstauschäden ein großes Risiko. Rückstau bedeutet, dass Wasser überfordertem Kanalnetz oder Abflussleitungen aus dem Kanal ins Haus zurückdrückt (typisch: über Kellerabflüsse, Toiletten, etc.). Stellen Sie sicher, dass Ihre Versicherung Rückstau durch Starkregen mitversichert – oft ist dies ebenfalls nur über den Elementarbaustein gedeckt. Wichtig: Viele Versicherer verlangen für die Leistung, dass technisch vorgesorgt wurde. Lassen Sie daher – falls nicht schon vorhanden – eine Rückstauklappe in Ihrem Kellerabflusssystem einbauen und halten Sie sie instand. Diese Ventile verhindern, dass Abwasser bei überlasteter Kanalisation ins Haus gedrückt wird. Ohne funktionierende Rückstau-Sicherung könnten Sie im Ernstfall nicht nur auf dem Schaden sitzenbleiben, sondern unter Umständen auch Probleme mit dem Versicherungsschutz bekommen.
- Bauliche Vorsorge gegen Wasserschäden: Denken Sie daran, dass nicht jeder Wasserschaden als „Naturereignis“ gilt. Wenn Wasser ins Haus eindringt, weil z.B. die Entwässerung unzureichend dimensioniert oder gewartet ist, kann der Versicherer den Schaden als baulichen Mangel werten – und dann nicht zahlen. Prävention ist daher essenziell: Halten Sie Abläufe, Drainagen und Dachrinnen frei von Laub und Schmutz, damit Starkregenwasser ordentlich abfließen kann. Kontrollieren Sie regelmäßig die Entwässerung von Lichtschächten, Terrassen und Kellerabgängen – bei Bedarf lassen Sie zusätzliche Abläufe oder Pumpensysteme installieren. Achten Sie auf ausreichend Gefälle vom Gebäude weg, damit sich kein Wasser am Haus staut. Undichte Kellerfenster, Türschwellen oder Mauerwerk sollten frühzeitig abgedichtet werden. Diese Maßnahmen liegen in Ihrer Eigenverantwortung und können entscheidend sein, um Wasserschäden vorzubeugen, die sonst nicht von der Versicherung abgedeckt wären.
Kurz gesagt: Überlassen Sie den Schutz Ihres Hauses nicht allein der Versicherung. Sorgen Sie mit einem passenden Vertrag für finanziellen Rückhalt im Ernstfall – und treffen Sie bauliche Vorkehrungen, damit es gar nicht erst zum Schaden kommt. So schlafen Sie als Grundstückseigentümer bei der nächsten Unwetterwarnung wesentlich ruhiger.